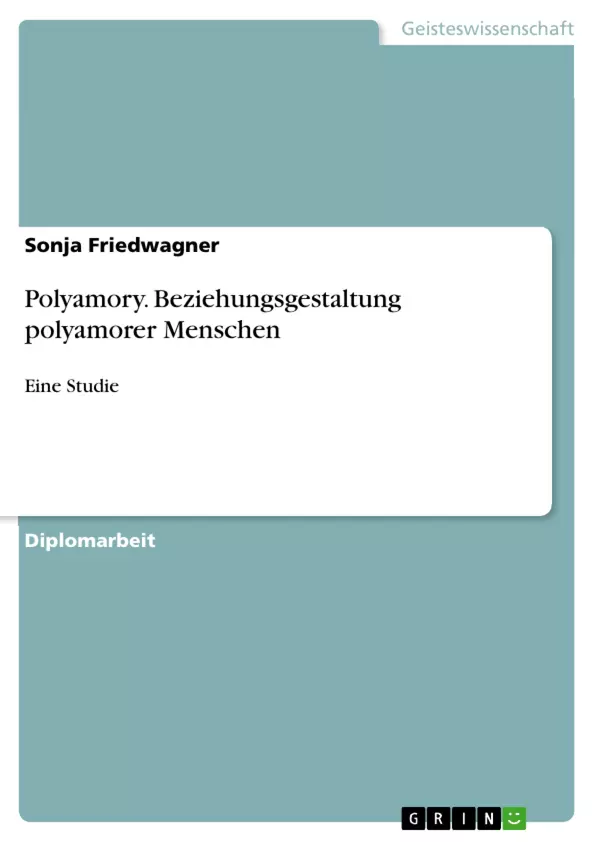The present paper is concerned with the less studied model of relationship of „Polyamory”. This definition stands for the practical experience of having a love relationship to more than one partner at the same time. In the awareness, that all involved partners know about it and are full conscious of the situation. This is the first exploration of “polyamore” relationships. The phenomenon “Polyamory” was determined with two methodical different approaches, defined in the “Triangulationsmodels”, which combined two methodical different approaches in two separate studies. There is a questionnaire and a code of practise. The participants are between the age of 20 and 55 . The questions relates to democraphic dates like age, gender graduation and profession. Furthermore was asked about how the “polyamore” relationship developed, sexual orientation, duration of the relationship and age of the partners. Another subject were children, who occured of such “polyamory” relationships. The question was, if there are children or not. If yes, how many and how they have been brought up? People were also asked, if they had any idea about this topic and the occurence in society. Some questions dealt with the quality of the relationship, frequency of contact and the local difference between the partners. Another big area was the social surroundings and the topic sexuality. Feelings of love and jealousy in “polyamory”relationships. At least “polyamory” people were asked in the questionnaire and interview what they thought would be worth mentioning.
Keywords Polyamory, Beziehung, Relationship, Liebe, Lov
Inhaltsverzeichnis
- 1. AUSGANGSÜBERLEGUNG
- I. THEORETISCHER TEIL
- 2. WAS IST EINE BEZIEHUNG?
- 2.1 PARTNERSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN
- 2.1.1 Eheliche Treue
- 2.1.2 Beziehungsgrenzen
- 2.1.3 Der Ehealltag als Lustkiller
- 2.2 GESCHICHTE DER LIEBESBEZIEHUNG
- 2.2.1 Trendwende in der Struktur der Partnerschaften
- 2.2.2 Die kulturelle Selektion von Veränderungen
- 2.2.3 Transitorische und Experimentelle Milieus – Beziehungen in der Zukunft
- 3. LIEBE UND SEXUALITÄT IN MODERNEN GESELLSCHAFTEN
- 3.1 ARTEN DER LIEBE
- 3.1.1 Warum gibt es Liebe?
- 3.1.2 Das Phänomen des Verliebens
- 3.1.3 Liebe als Faktor für den Zusammenhalt von Paaren
- 3.2 VERÄNDERUNGEN SEXUELLER EINSTELLUNGEN UND VERHALTENSWEISEN IM 20. JAHRHUNDERT
- 3.3 SEXUELLES VERHALTEN
- 4. POLYAMORY
- 4.1 FORMEN POLYAMORER BEZIEHUNGEN
- 4.2 POLYAMORY UND GESELLSCHAFT
- 4.3 BEISPIELE POLYAMORER BEZIEHUNGEN
- 4.3.1 Benennungen und Beziehungskonstellationen
- 4.3.2 Eifersucht in polyamoren Beziehungen
- 4.4 ZUR POLYAMOREN LEBENSWEISE
- 4.5 ABGRENZUNGEN ZWISCHEN POLYFIDELITY, VIELEHE UND FREIE EHE
- 5. BISHERIGE FORSCHUNG ZU POLAMORY
- 5.1 ZUM STAND DER FORSCHUNG ZU POLYAMORY
- 5.2 MOTIVE FÜR DIE WAHL EINER NICHT-MONOGAMEN LEBENSWEISE
- 5.3 SUBJEKTIVE BEGRÜNDUNGEN POLYAMORER BEZIEHUNGEN
- 5.4 VERBINDLICHKEIT IN POLYAMOREN BEZIEHUNGEN
- 5.5 DIE BEDEUTUNG DER POLYAMORY FÜR DIE ROLLE DER FRAU
- 5.6 KOSTEN, BELASTUNGEN UND NUTZEN POLYAMORER BEZIEHUNGEN
- 5.7 ZUSAMMENFASSUNG UND OFFENE FORSCHUNGSFRAGEN
- II. EMPIRISCHER TEIL
- 6. FRAGESTELLUNGEN
- 7. VERSUCHSPLAN UND UNTERSUCHUNGSDESIGN
- 8. UNTERSUCHUNGSMETHODE
- 8.1 METHODISCHES HERANGEHEN
- 8.2 UNTERSUCHUNGSDESIGN
- 8.3 STICHPROBE
- 8.4 METHODIK UND INSTRUMENTE
- 8.4.1 Kombination und Integration qualitativer und quanitativer Analyse
- 8.4.2 Problemzentriertes Interview
- 8.4.3 Fragebogen zu polyamoren Beziehungen
- 8.4.4 Triangulationsmodell
- 8.4.5 Struktur und Datenerhebung
- 8.5 ENTWICKLUNG DES INTERVIEWLEITFADENS UND FRAGEBOGENS
- 8.6 GEPLANTE AUSWERTUNG DER DATEN
- 8.6.1 Geplante Auswertung qualitativer Teil
- 8.6.2 Geplante statistische Auswertung des Fragebogens
- 8.7 ETHISCHE UND JURISTISCHE ASPEKTE DER STUDIE
- 8.8 METHODENKRITISCHE DISKUSSION DER VERSUCHSPLANUNG
- 8.9 DURCHFÜHRUNG DER STUDIE
- 9. ERGEBNISSE
- 9.1 ZUSAMMENSETZUNG DER STICHPROBE
- 9.1.1 Quantitative Studie
- 9.2 QUALITATIVER TEIL
- 9.3 QUANTITATIVER TEIL
- 9.3.1 Beschreibung der Stichprobe
- 9.3.2 Struktur der Beziehungen
- 9.3.3 Kinder in polyamoren Beziehungen
- 9.3.4 Lebensweise in polyamoren Beziehungen
- 9.3.5 Stellenwert der polyamoren Partner und Partnerinnen
- 9.3.6 Die Beziehungsqualität polyamorer Beziehungen
- 9.3.7 Soziale Unterstützung in polyamoren Beziehungen
- 9.3.8 Umgang mit Konflikten und Eifersucht in polyamoren Beziehungen
- 9.3.9 Sexualität in polyamoren Beziehungen
- 9.3.10 Offene Frage
- 9.3.10.1 Polyamore Beziehungen, Definition, Gestaltung
- 9.3.10.2 Kritik am Fragebogen
- 9.4 VERKNÜPFUNG DER QUALITATIVEN UND QUANTITATIVEN ERGEBNISSE IM SINNE DER TRIANGULATION
- 9.4.1 Struktur der Beziehungen
- 9.4.2 Kinder in polyamoren Beziehungen
- 9.4.3 Polyamore Lebensweise
- 9.4.4 Stellenwert der Partner und Partnerinnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Beziehungsgestaltung polyamor lebender Menschen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Lebensweise, der Herausforderungen und der positiven Aspekte polyamorerer Beziehungen zu zeichnen. Die Arbeit verbindet qualitative und quantitative Forschungsmethoden, um ein tiefes Verständnis der Thematik zu ermöglichen.
- Definition und verschiedene Formen von Polyamorie
- Soziale und gesellschaftliche Wahrnehmung von Polyamorie
- Herausforderungen und Bewältigungsstrategien in polyamoren Beziehungen
- Positive Aspekte und die Bedeutung von Polyamorie für die Beteiligten
- Vergleich mit monogamen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ausgangsüberlegung: Dieses einleitende Kapitel skizziert den Forschungsgegenstand Polyamorie und begründet die Relevanz der Untersuchung. Es stellt die Forschungsfrage auf und umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit, welcher die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden vorsieht. Die Ausgangshypothese beinhaltet die Annahme, dass polyamore Beziehungen trotz der Komplexität und der gesellschaftlichen Vorurteile positive Aspekte und ein hohes Maß an Zufriedenheit bieten können. Die Ausgangsüberlegung dient als Fundament für die darauffolgenden theoretischen und empirischen Abschnitte.
2. Was ist eine Beziehung?: Dieses Kapitel liefert einen theoretischen Hintergrund, indem es verschiedene Beziehungsformen und ihre historischen Entwicklungen beleuchtet. Es analysiert konventionelle Partnerschaften, die Herausforderungen des Alltags und die gesellschaftlichen Normen bezüglich Ehe und Treue. Es werden verschiedene Arten der Liebe erörtert und die Veränderungen sexueller Einstellungen und Verhaltensweisen im 20. Jahrhundert betrachtet. Das Kapitel dient als Grundlage, um Polyamorie im Kontext traditioneller Beziehungsmuster zu verstehen.
3. Liebe und Sexualität in modernen Gesellschaften: Dieser Abschnitt erweitert den theoretischen Rahmen und betrachtet die verschiedenen Arten von Liebe, das Phänomen des Verliebens und die Rolle der Liebe im Beziehungszusammenhang. Zudem werden die Veränderungen sexueller Einstellungen und Verhaltensweisen im 20. Jahrhundert untersucht, um den Kontext der heutigen, vielfältigeren Beziehungsmuster zu beleuchten. Es wird der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf individuelle Liebes- und Sexualitätstheorien analysiert.
4. Polyamorie: Dieses Kapitel definiert Polyamorie und beschreibt verschiedene Formen polyamorerer Beziehungen. Es beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung von Polyamorie und bietet Fallbeispiele polyamorerer Beziehungen. Hier werden verschiedene Beziehungsstrukturen und ihre Herausforderungen sowie die Rolle von Eifersucht analysiert. Das Kapitel dient der konkreten Illustration der Forschungsfrage.
5. Bisherige Forschung zu Polamory: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Polyamorie. Er diskutiert verschiedene Studien und Erkenntnisse über Motive für nicht-monogame Lebensweisen, subjektive Begründungen polyamorerer Beziehungen, die Bedeutung von Verbindlichkeit, und die Rolle der Frau in diesen Beziehungen. Die Kosten, Belastungen und Nutzen polyamorerer Beziehungen werden ebenso betrachtet, zusammen mit offenen Forschungsfragen. Es wird die Lücke in der aktuellen Forschung herausgestellt, die diese Arbeit füllen will.
6. Fragestellungen: Kapitel 6 präsentiert die konkreten Forschungsfragen, die im empirischen Teil der Arbeit beantwortet werden sollen. Es formuliert präzise Hypothesen über die Beziehungsgestaltung in polyamoren Konstellationen und benennt die zu untersuchenden Aspekte, um die Forschungslücke im Kontext der Polyamorie zu schließen.
7. Versuchsplan und Untersuchungsdesign: In diesem Kapitel wird die Methodik der Studie detailliert beschrieben, inklusive des gewählten Forschungsdesigns, der Stichprobenauswahl und der Datenerhebungsinstrumente. Es wird die Begründung der Wahl der Methode geliefert und die zu erwartenden Ergebnisse werden skizziert. Der Fokus liegt auf der Erklärung des gewählten Mixed-Methods-Ansatzes, der die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden zur Datenerhebung und -analyse beinhaltet.
8. Untersuchungsmethode: Dieses Kapitel bietet eine ausführliche Beschreibung der verwendeten Methoden, wie problemzentrierte Interviews und Fragebögen, und der Analysemethoden zur Auswertung der erhobenen Daten. Die Kapitel erläutert die verschiedenen Instrumente, das Triangulationsmodell und die ethischen Aspekte der Studie. Es beinhaltet eine methodenkritische Diskussion und eine detaillierte Darstellung der Durchführung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Polyamore Beziehungen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Beziehungsgestaltung polyamor lebender Menschen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Lebensweise, Herausforderungen und positiven Aspekte polyamorerer Beziehungen zu zeichnen.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert qualitative und quantitative Forschungsmethoden. Qualitative Daten werden durch problemzentrierte Interviews erhoben, quantitative Daten durch Fragebögen. Ein Triangulationsmodell dient zur Verknüpfung beider Datensätze.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil umfasst die Definition von Beziehungen, verschiedene Arten von Liebe, die Geschichte der Liebesbeziehung, Veränderungen sexueller Einstellungen und Verhaltensweisen im 20. Jahrhundert und eine detaillierte Darstellung von Polyamorie, einschließlich verschiedener Formen und gesellschaftlicher Wahrnehmung.
Was wird im empirischen Teil untersucht?
Der empirische Teil beinhaltet die Beschreibung des Versuchsplans und Untersuchungsdesigns, die detaillierte Darstellung der Methodik (inkl. Stichprobenbeschreibung, Instrumenten und Auswertung), die Präsentation der Ergebnisse (qualitativ und quantitativ) und die Verknüpfung der Ergebnisse im Sinne der Triangulation.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die konkreten Forschungsfragen werden in Kapitel 6 formuliert. Sie zielen darauf ab, Aspekte der Beziehungsgestaltung, Herausforderungen, positive Aspekte und den Vergleich mit monogamen Beziehungen zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst Kapitel 1-5 (Ausgangsüberlegung, Was ist eine Beziehung?, Liebe und Sexualität, Polyamorie, Bisherige Forschung). Der empirische Teil umfasst Kapitel 6-9 (Fragestellungen, Versuchsplan, Untersuchungsmethode, Ergebnisse).
Wie werden die Ergebnisse ausgewertet?
Die Auswertung erfolgt sowohl qualitativ (Interpretationsanalyse der Interviews) als auch quantitativ (statistische Auswertung der Fragebögen). Die Ergebnisse werden im Sinne eines Triangulationsmodells verknüpft, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
Welche Hypothesen werden aufgestellt?
Die Ausgangshypothese geht davon aus, dass polyamore Beziehungen trotz Komplexität und gesellschaftlicher Vorurteile positive Aspekte und ein hohes Maß an Zufriedenheit bieten können. Weitere, spezifische Hypothesen werden in Kapitel 6 formuliert.
Welche ethischen und juristischen Aspekte werden berücksichtigt?
Kapitel 8.7 widmet sich den ethischen und juristischen Aspekten der Studie, um die Rechte und den Datenschutz der Teilnehmer zu gewährleisten.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die einen Überblick über die Inhalte und die Argumentationslinien jedes Abschnitts bietet.
- Citation du texte
- Sonja Friedwagner (Auteur), 2011, Polyamory. Beziehungsgestaltung polyamorer Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180924