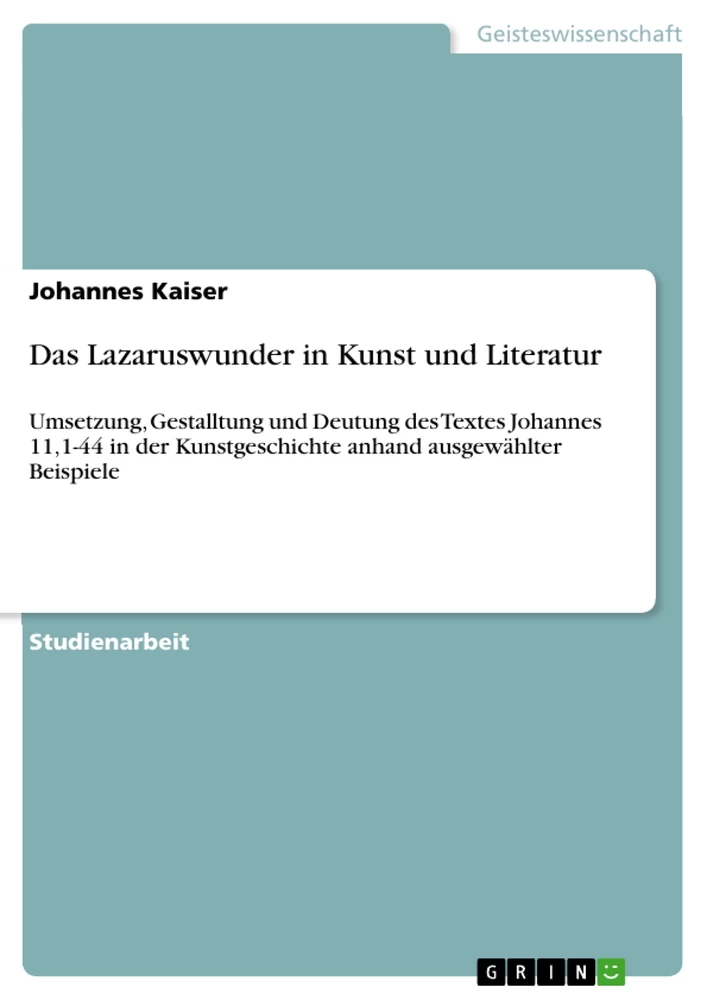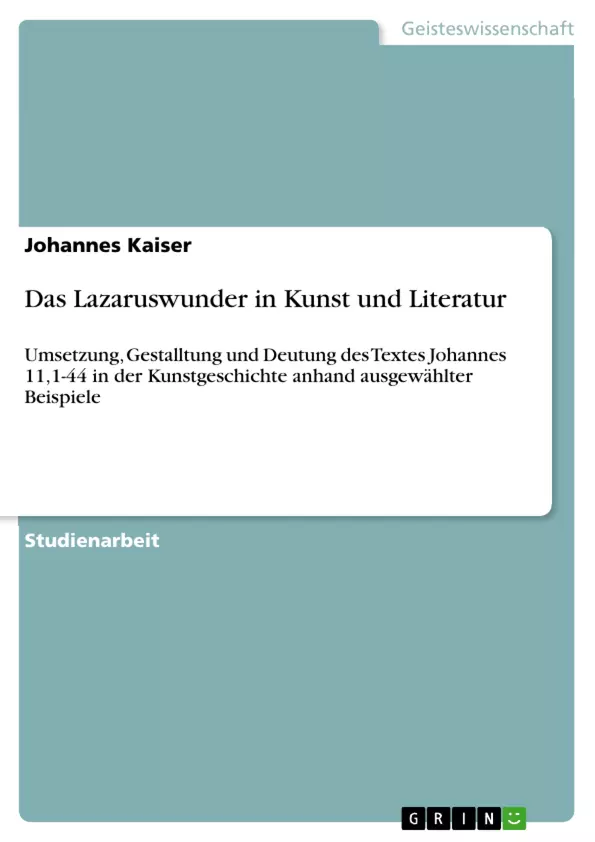Neben der Auferstehung Jesu Christi stellt das Wunder um die Auferweckung des Lazarus den Höhepunkt der Wunderwirksamkeit des Messias´ im Johannesevangelium dar. Kein anderes Wunder wurde so überhöht dargestellt wie dieses. Ein Mensch, der bereits 4 Tage tot ist und an dem sogar schon der Verwesungsprozess eingesetzt hat, wird zum Leben erweckt. Selbst aus heutiger Sicht wäre solch ein Wiederbelebungsversuch absolut unmöglich. Es ist also wenig überraschend, dass diese Geschichte die Menschen immer wieder bewegt hat und so manchem Künstler Inspiration bot. Die Aufgabe dieser Arbeit soll es nun sein Betrachtungen anzustellen, wie man das Wunder in den verschieden Epochen verstand und was man daran als besonders Wichtig daran erachtete. Dazu werde ich exemplarisch je ein Werk aus dem frühen Christentum, aus dem Mittelalter und dem Barock bis hin zu einem Gedicht Rilkes aus dem 20. Jahrhundert untersuchen. Das Ziel soll dabei sein, anhand der Darstellungen und Gestaltungsweisen die verschiedenen Interpretationen des Wunders in der Geschichte hindurch nachvollziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das frühe Christentum - Die Calixtuskatakomben in Rom
- Kunstgeschichte
- Umsetzung und Gestaltung
- Deutung
- Das Mittelalter: Evangeliar Otto III.
- Kunstgeschichte
- Umsetzung und Gestaltung
- Deutung
- Barock: Rembrandt van Rijn
- Kunstgeschichte
- Umsetung und Gestaltung
- Deutung
- Moderne: Rainer Maria Rilke
- Literaturgeschichte Ende des 19. Jahrhunderts
- Umsetzung und gestaltung
- Deutung
- Resümee
- Literaturverzeichnis
- Quellennachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die künstlerische Umsetzung und Deutung des Lazaruswunders im Johannesevangelium in verschiedenen Epochen. Sie analysiert exemplarisch ausgewählte Werke aus dem frühen Christentum, dem Mittelalter, dem Barock und der Moderne, um die unterschiedlichen Interpretationen des Wunders in der Geschichte nachzuvollziehen.
- Die Entwicklung der christlichen Bilderlehre und die Frage des Bilderverbots
- Die künstlerische Gestaltung des Lazaruswunders in verschiedenen Epochen
- Die Deutung des Wunders als Ausdruck der Macht und Wirksamkeit Jesu Christi
- Die Rezeption des Lazaruswunders in der Literatur und Kunst
- Die Bedeutung des Lazaruswunders für das christliche Selbstverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Lazaruswunder als Höhepunkt der Wunderwirksamkeit Jesu Christi im Johannesevangelium vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Das Kapitel über das frühe Christentum analysiert die Fresken in den Calixtuskatakomben in Rom, die das Lazaruswunder darstellen. Es beleuchtet die Entwicklung der christlichen Bilderlehre und die Frage des Bilderverbots im frühen Christentum. Das Kapitel über das Mittelalter untersucht das Evangeliar Otto III., das das Lazaruswunder in einer illuminierten Handschrift darstellt. Es beleuchtet die Bedeutung des Lazaruswunders für die mittelalterliche Kunst und Theologie. Das Kapitel über den Barock analysiert das Gemälde von Rembrandt van Rijn, das das Lazaruswunder darstellt. Es beleuchtet die Bedeutung des Lazaruswunders für die Barockkunst und die Rezeption des Wunders in der niederländischen Malerei. Das Kapitel über die Moderne analysiert das Gedicht von Rainer Maria Rilke, das sich mit dem Lazaruswunder auseinandersetzt. Es beleuchtet die Bedeutung des Lazaruswunders für die moderne Literatur und die Rezeption des Wunders in der deutschen Literatur.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Lazaruswunder, das Johannesevangelium, die Kunstgeschichte, die Literaturgeschichte, die christliche Bilderlehre, die Deutung von Wundern, die Macht und Wirksamkeit Jesu Christi, die Rezeption des Lazaruswunders in der Kunst und Literatur sowie die Bedeutung des Lazaruswunders für das christliche Selbstverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt das Lazaruswunder als Höhepunkt der Wunder Jesu im Johannesevangelium?
Es ist die einzige Schilderung einer Auferweckung eines Menschen, der bereits vier Tage tot war und bei dem der Verwesungsprozess bereits eingesetzt hatte.
Welche Epochen der Kunstgeschichte werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert Werke aus dem frühen Christentum (Katakomben), dem Mittelalter, dem Barock (Rembrandt) und der Moderne (Rilke).
Wie deutet Rainer Maria Rilke das Lazaruswunder im 20. Jahrhundert?
Rilke nähert sich dem Wunder literarisch und reflektiert die existenziellen und psychologischen Dimensionen der Rückkehr ins Leben.
Welche Rolle spielt das Bilderverbot im frühen Christentum für die Lazarus-Darstellung?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der christlichen Bilderlehre und wie trotz Vorbehalten erste visuelle Deutungen in den Calixtuskatakomben entstanden.
Was ist das Ziel des Epochenvergleichs in dieser Arbeit?
Das Ziel ist es, den Wandel in der Interpretation der göttlichen Macht und des christlichen Selbstverständnisses über die Jahrhunderte hinweg nachzuvollziehen.
- Citation du texte
- Johannes Kaiser (Auteur), 2011, Das Lazaruswunder in Kunst und Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181000