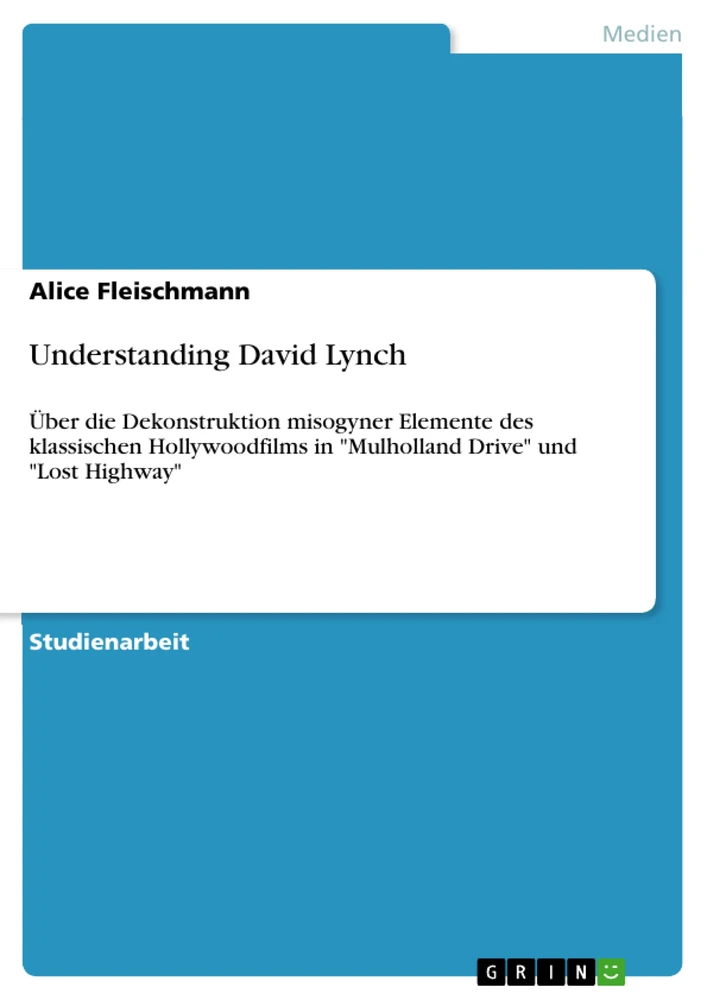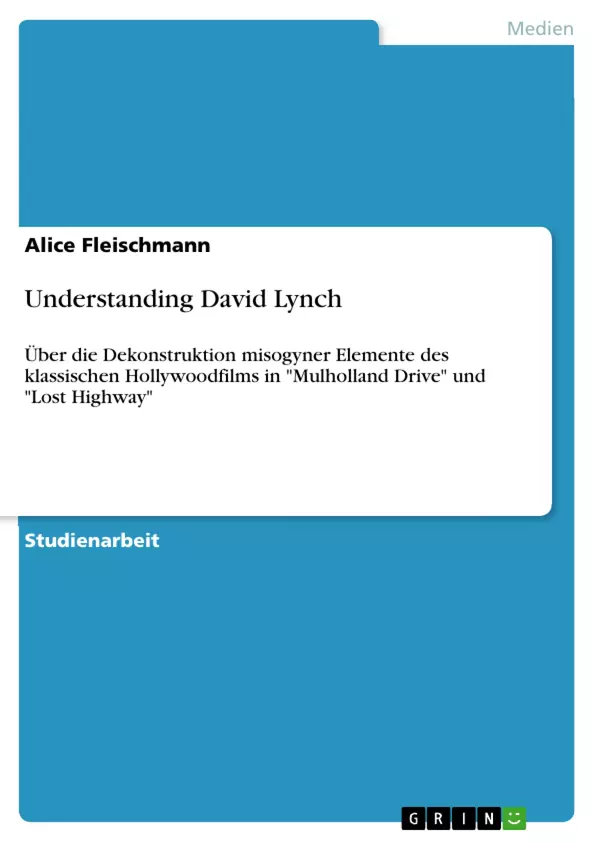David Lynchs Filme gehören zu den vieldiskutierten der Gegenwart. Dass Lynch sich vehement weigert, Erläuterungen zu seinen Filmen abzugeben, beziehungsweise zum Teil widersprüchliche Angaben macht, nährt entsprechende Diskussionen sicherlich, ebenso wie böse Unterstellungen bezüglich mangelnder Sinnhaftigkeit seiner Werke. In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene, teils weit verbreitete Interpretationen seiner populärsten Filme "Mulholland Drive" und "Lost Highway" vorgestellt und anschließend um eine eigene ergänzt, welcher wiederum die Neuordnung der Szenenabfolge zugrunde liegt. Im Zuge dessen wird außerdem auf die Traumdeutung nach Sigmund Freud im Zusammenspiel mit aktuell relevanten Erkenntnissen der Traumforschung eingegangen.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Annahme, dass Lynchs Filme, entgegen verbreiteter Vorurteile, keinesfalls eine misogyne - sprich frauenfeindliche - Grundhaltung an den Tag legen, sondern gar das exakte Gegenteil implizieren. Hierzu wird unter anderem auf Laura Mulveys Theorie des "male gaze" eingegangen; zudem werden von Lynch verwendete Stilmittel herausgearbeitet und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Understanding David Lynch: Wege zur Deutung
- Naive Ansätze zu Lost Highway und Mulholland Drive
- Ein mystischer Thriller?
- Paralleluniversen in Hollywood
- Lynchville psychoanalytisch: Todd McGowan/Slavoj Žižek
- Lost Highway
- Mulholland Drive
- Vergleich der Ansätze
- "I thought sleep would do it...\" - Versuch einer lückenlosen Interpretation
- Träume, Traumdeutung und Film
- Die richtige Reihenfolge
- Die Dekonstruktion misogyner Elemente des klassischen Hollywoodfilms
- Der Traum als stilistisches Mittel zur Darstellung von Stereotypen
- Reproduzierte Misogynie zum Zweck der Entlarvung
- Übertreibung und Ironie
- Weibliche vs. männliche Misogynie
- Literaturverzeichnis
- Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse und Interpretation der Filme von David Lynch, insbesondere von "Lost Highway" und "Mulholland Drive". Das Ziel ist es, verschiedene Deutungsansätze zu untersuchen und eine umfassende Interpretation der Filme zu entwickeln, die sowohl inhaltliche als auch intentionale Aspekte berücksichtigt. Dabei wird besonderer Wert auf die Dekonstruktion misogyner Elemente des klassischen Hollywoodfilms gelegt.
- Interpretationen von Lynchs Filmen: Naive Ansätze, psychoanalytische Interpretationen und eine neuartige Deutung basierend auf der Traumtheorie
- Analyse der filmischen Struktur und narrativen Logik von "Lost Highway" und "Mulholland Drive"
- Die Rolle von Stereotypen und der "male gaze" in Lynchs Filmen
- Dekonstruktion misogyner Elemente durch Ironie und Übertreibung
- Die Frage, ob Lynchs Filme absichtlich misogyn sind oder ob sie diese Elemente vielmehr satirisch aufgreifen und dekonstruieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der korrekten Interpretation von Lynchs Filmen vor. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Deutungsansätze für "Lost Highway" und "Mulholland Drive", beginnend mit naiven Interpretationen und anschließend mit der Auseinandersetzung mit psychoanalytischen Interpretationen. Im Anschluss wird eine neuartige Deutung vorgestellt, die die Filme als Träume interpretiert.
Kapitel 3 widmet sich der Dekonstruktion misogyner Elemente im klassischen Hollywoodfilm anhand der beiden ausgewählten Filme. Hier wird untersucht, wie Lynch Stereotypen, den "male gaze" und misogyne Elemente nutzt, um sie ironisch zu überspitzen und ad absurdum zu führen. Das Kapitel untersucht auch die Frage, ob Lynchs Filme tatsächlich misogyn sind oder ob sie diese Elemente bewusst einsetzten, um sie zu dekonstruieren.
Schlüsselwörter
David Lynch, Lost Highway, Mulholland Drive, Filmdeutung, psychoanalytische Interpretation, Traumdeutung, Misogynie, Stereotypen, "male gaze", klassische Hollywoodfilme, Ironie, Dekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen
Wie lassen sich Lynchs Filme "Mulholland Drive" und "Lost Highway" deuten?
Die Arbeit stellt verschiedene Ansätze vor, von naiven mystischen Interpretationen über psychoanalytische Deutungen (Žižek) bis hin zu Modellen der Traumforschung.
Sind David Lynchs Filme frauenfeindlich?
Die Arbeit argumentiert gegen dieses Vorurteil und zeigt auf, dass Lynch misogyne Elemente des klassischen Hollywoods vielmehr dekonstruiert und entlarvt.
Was bedeutet "male gaze" in diesem Kontext?
Der "männliche Blick" (Theorie von Laura Mulvey) beschreibt die Objektifizierung der Frau im Film. Lynch nutzt Übertreibung und Ironie, um diesen Blick kritisch zu hinterfragen.
Welche Rolle spielt Sigmund Freud für das Verständnis der Filme?
Die Traumdeutung nach Freud dient als Werkzeug, um die verschachtelten Szenenabfolgen und Symbole als Ausdruck des Unbewussten der Protagonisten zu verstehen.
Warum verweigert David Lynch Erläuterungen zu seinen Werken?
Lynch lässt seine Filme lieber für sich selbst sprechen, um den Zuschauer zu eigenen Interpretationen anzuregen und die mystische Wirkung nicht durch rationale Erklärungen zu zerstören.
- Citar trabajo
- Alice Fleischmann (Autor), 2011, Understanding David Lynch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181007