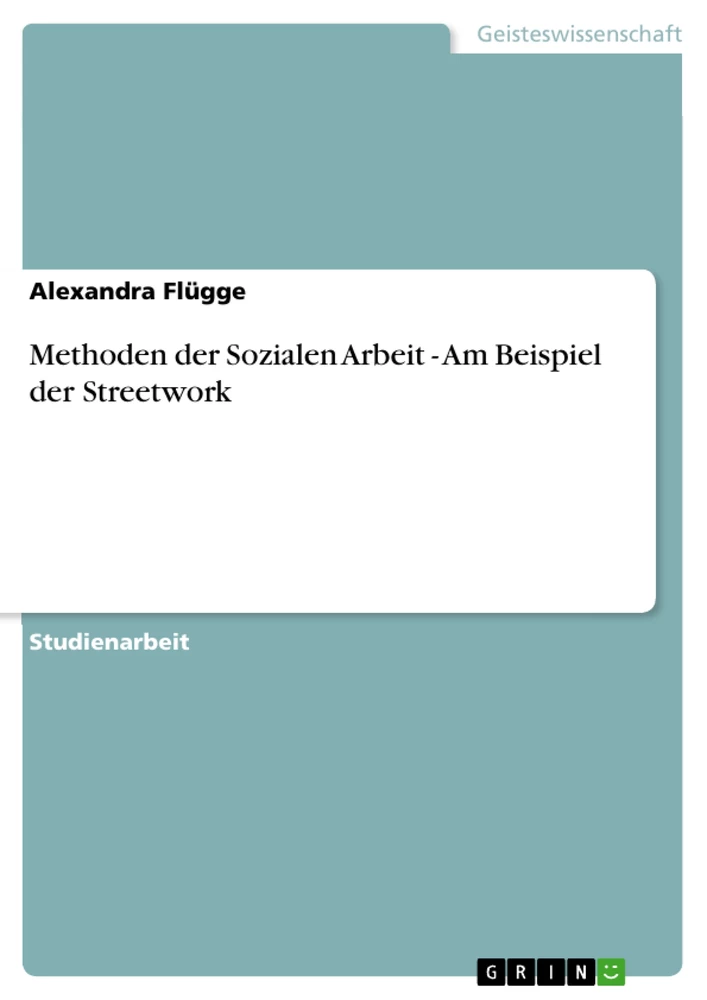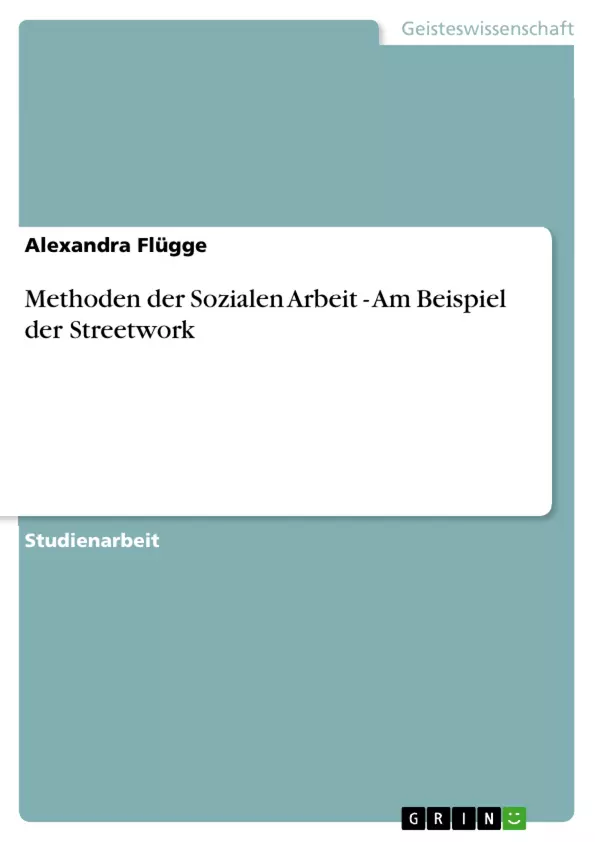In der vorliegenden Hausarbeit werde ich eine Methode der sozialen Arbeit
näher erläutern. Streetwork (übersetzt Straßenarbeit), ist eine Lebenswelt nahe
Sozialarbeit, da streetworker nicht in einer Institution arbeiten, sondern im
Lebensumfeld ihrer jeweiligen Zielgruppen.
Im ersten Kapitel gebe ich eine kurze Definition des Begriffes „streetwork“. Die
Definition gibt einen ersten Eindruck, was ein streetworker ist und wo die
Schwerpunkte seiner Arbeit liegen.
Im zweiten Kapitel gehe ich auf die Geschichte des streetworking's ein. Eine nähere
Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung der mobilen Jugendarbeit halte ich für
wichtig, da es Hintergrundwissen vermittelt und zum Verständnis der heutigen
Situation beiträgt.
Das dritte Kapitel, der Forschungsgegenstand, beleuchtet weitere Aspekte des
streetworking's. Ich gehe auf die theoretischen und rechtlichen Grundlagen näher
ein. Bei den theoretischen Grundlagen fokussiere ich die Ziele, Aufgaben, Methoden,
Prinzipien, Rahmenbedingungen sowie die Qualitätssicherung.
Im vierten Kapitel stelle ich ein aktuelles Projekt des streetworking's vor. Das
Projekt heißt „off road kids“. Es werden in mehreren großen deutschen Städten
Straßenkinder betreut.
Im fünften Kapitel werde ich die wichtigsten Ergebnisse kurz
zusammenfassen. Außerdem werde ich Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen
ziehen, welche Schritte in meinen Augen für die Weiterentwicklung der
streetworking's notwendig sind.
Das Ziel der Hausarbeit ist es, einen Überblick der mobilen Jugendarbeit zu
geben.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definition
- 2. Geschichte der Streetwork
- 2.1 Entwicklung der Streetwork
- 2.2 USA
- 2.3 Deutschland
- 3. Forschungsgegenstand
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 3.1.1 Ziele und Aufgaben der Streetwork
- 3.1.2 Methoden
- 3.1.3 Prinzipien
- 3.1.4 Rahmenbedingungen
- 3.1.5 Qualitätssicherung
- 3.2 Rechtliche Grundlagen
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 4. Aktualität
- 4.1 Was ist off road kids?
- 4.2 Finanzierung und Träger
- 4.3 Arbeitsfelder und Ziele
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bietet einen Überblick über Streetwork als Methode der Sozialen Arbeit. Die Arbeit untersucht die Definition, Geschichte, theoretischen und rechtlichen Grundlagen sowie aktuelle Projekte. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der mobilen Jugendarbeit zu vermitteln.
- Definition und Charakteristika von Streetwork
- Historische Entwicklung der Streetwork in den USA und Deutschland
- Theoretische Grundlagen: Ziele, Methoden und Prinzipien
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Streetwork
- Aktuelle Praxisbeispiele (z.B. "off road kids")
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Streetwork ein und beschreibt den Aufbau der Hausarbeit. Sie skizziert die einzelnen Kapitel und ihre jeweiligen Schwerpunkte, um dem Leser einen klaren Überblick über den Inhalt zu geben und die Struktur der Arbeit vorwegzunehmen.
1. Definition: Dieses Kapitel definiert Streetwork als lebensweltnahe Sozialarbeit, die im direkten Umfeld der Zielgruppen stattfindet. Es hebt die Unterschiede zu institutioneller Sozialarbeit hervor, betont die umgekehrte Beziehung zwischen Streetworker und Klient und die Notwendigkeit, sich auf die jeweiligen Szenen und deren Regeln einzustellen. Der Fokus liegt auf der Arbeit mit sozial benachteiligten und gefährdeten Jugendlichen, deren Sozialleben sich hauptsächlich auf der Straße abspielt.
2. Geschichte der Streetwork: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Streetwork, wobei verschiedene Perspektiven auf den Ursprung diskutiert werden. Es werden frühe Formen mobiler Jugendarbeit als Vorläufer betrachtet und die Entwicklung in den USA (Chicagoer Schule) im Kontext hoher Jugendkriminalität erläutert. Das Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln und den Wandel der Streetwork über die Zeit.
3. Forschungsgegenstand: Der Forschungsgegenstand befasst sich mit den theoretischen und rechtlichen Grundlagen der Streetwork. Im theoretischen Teil werden Ziele, Aufgaben, Methoden, Prinzipien, Rahmenbedingungen und Qualitätssicherung im Detail erläutert. Der rechtliche Teil beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen der Arbeit mit den Zielgruppen. Das Kapitel verbindet Theorie und Praxis und liefert damit eine fundierte Basis für das Verständnis der Streetwork.
4. Aktualität (Das Projekt "off road kids"): Dieses Kapitel präsentiert das Projekt "off road kids" als Beispiel aktueller Streetwork. Es werden die Zielgruppen, die Finanzierung, die Träger und die Arbeitsfelder des Projekts beschrieben, um einen Einblick in die konkrete Anwendung von Streetwork in der Praxis zu geben. Der Fokus liegt auf der Darstellung eines aktuellen Praxisbeispiels und dessen Relevanz im Kontext der zuvor beschriebenen theoretischen und historischen Grundlagen.
Schlüsselwörter
Streetwork, mobile Jugendarbeit, soziale Arbeit, Jugendhilfe, lebensweltorientierte Arbeit, sozial benachteiligte Jugendliche, gefährdete Jugendliche, theoretische Grundlagen, rechtliche Grundlagen, Methoden, Prinzipien, Qualitätssicherung, "off road kids", Chicagoer Schule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Streetwork
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Streetwork als Methode der Sozialen Arbeit. Sie behandelt die Definition, Geschichte, theoretischen und rechtlichen Grundlagen sowie aktuelle Praxisbeispiele. Der Fokus liegt auf der Vermittlung eines umfassenden Verständnisses der mobilen Jugendarbeit.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Charakteristika von Streetwork, historische Entwicklung in den USA und Deutschland, theoretische Grundlagen (Ziele, Methoden, Prinzipien), rechtliche Rahmenbedingungen, und aktuelle Praxisbeispiele (z.B. "off road kids").
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, fünf Kapitel und ein Fazit. Die Kapitel behandeln nacheinander die Definition von Streetwork, ihre Geschichte, die theoretischen und rechtlichen Grundlagen sowie ein aktuelles Praxisbeispiel ("off road kids"). Die Einleitung beschreibt den Aufbau und die einzelnen Kapitel werden jeweils zusammengefasst.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Streetwork laut der Hausarbeit?
Die theoretischen Grundlagen umfassen Ziele, Aufgaben, Methoden, Prinzipien, Rahmenbedingungen und die Qualitätssicherung der Streetwork. Die Hausarbeit erläutert diese Aspekte detailliert und verbindet Theorie und Praxis.
Welche rechtlichen Grundlagen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, die für die Arbeit mit den Zielgruppen der Streetwork relevant sind.
Welches aktuelle Projekt wird als Beispiel vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert das Projekt "off road kids" als Beispiel für aktuelle Streetwork. Beschrieben werden die Zielgruppen, Finanzierung, Träger und Arbeitsfelder des Projekts.
Was sind die Schlüsselwörter der Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Streetwork, mobile Jugendarbeit, soziale Arbeit, Jugendhilfe, lebensweltorientierte Arbeit, sozial benachteiligte Jugendliche, gefährdete Jugendliche, theoretische Grundlagen, rechtliche Grundlagen, Methoden, Prinzipien, Qualitätssicherung, "off road kids", Chicagoer Schule.
Wie wird die Geschichte der Streetwork dargestellt?
Die Geschichte der Streetwork wird anhand der Entwicklung in den USA (Chicagoer Schule) und Deutschland beleuchtet. Es werden frühe Formen mobiler Jugendarbeit als Vorläufer betrachtet und der Wandel der Streetwork über die Zeit beschrieben.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist es, ein umfassendes Verständnis von Streetwork als Methode der Sozialen Arbeit zu vermitteln.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Studierende der Sozialen Arbeit, Personen, die sich für Streetwork und mobile Jugendarbeit interessieren, sowie für Fachkräfte im Bereich der Jugendhilfe.
- Quote paper
- Alexandra Flügge (Author), 2011, Methoden der Sozialen Arbeit - Am Beispiel der Streetwork, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181074