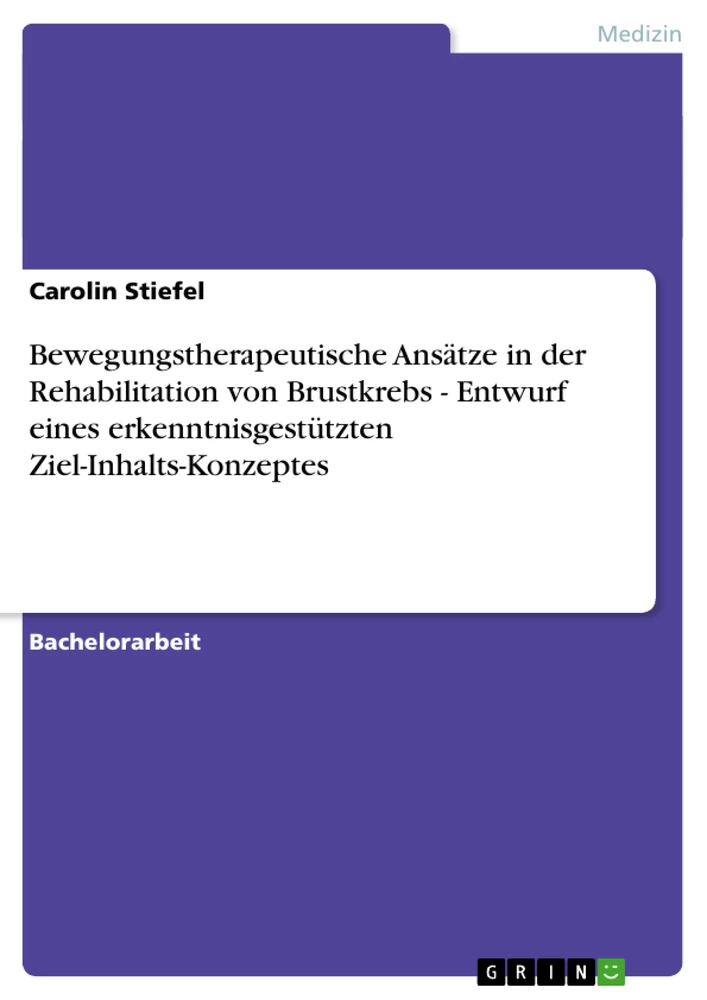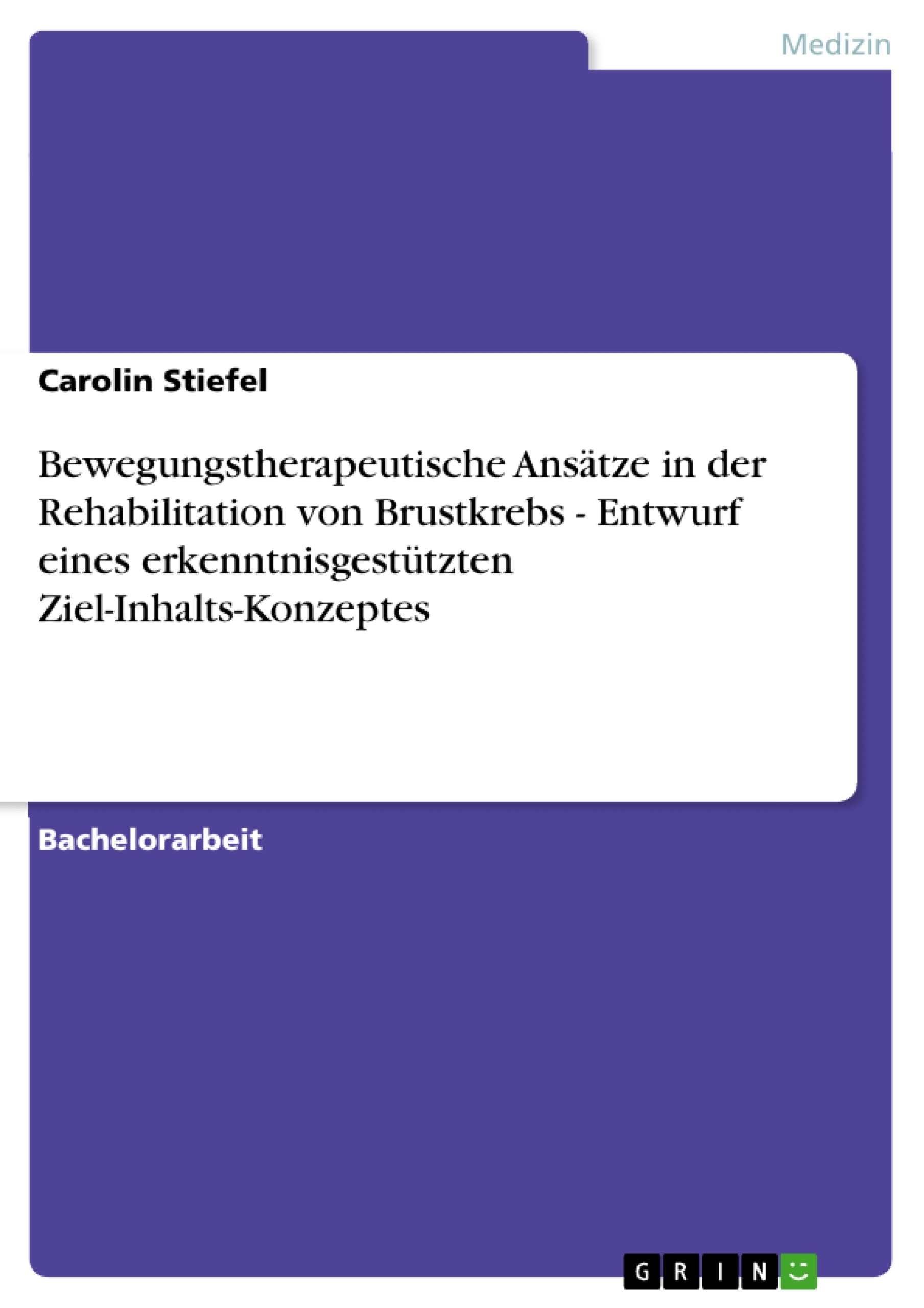[...] In der vorliegenden Arbeit wird versucht, aus den Zielen der bewegungstherapeutischen Arbeit
mit Brustkrebspatientinnen in der Rehabilitation, Inhalte abzuleiten, die zu diesen Zielen führen
können. Die inhaltlichen Empfehlungen stützen sich auf Erkenntnisse der allgemeinen
Trainingslehre, Trainingsempfehlungen für den Gesundheitssport, sowie auf
Trainingsmethoden, die im Rahmen von Studien zur Bewegungsintervention mit
Brustkrebspatientinnen eingesetzt wurden.
Folgende Fragestellungen sollen wegweisend durch die Arbeit führen:
- Welche Möglichkeiten der bewegungstherapeutischen Begleitung von Krebspatienten gibt
es während der einzelnen Behandlungsstadien?
- Welche positiven Wirkungen bewegungstherapeutischer Maßnahmen im Sinne der
Rehabilitation werden in der Literatur beschrieben?
- Welche Ziele sollen durch bewegungstherapeutische Interventionen in der Rehabilitation
von Brustkrebspatientinnen erreicht werden?
- Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die inhaltliche Gestaltung von
Bewegungsinterventionen in der Rehabilitation von Brustkrebspatientinnen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Brustkrebs - medizinische und allgemeine Grundlagen
- 2.1. Epidemiologie
- 2.2. Physiologische Grundlagen
- 2.2.1. Aufbau der weiblichen Brust
- 2.2.2. Nicht-invasive Karzinome
- 2.2.3. Invasive Karzinome
- 2.3. Ätiologie und Risikofaktoren
- 2.4. Therapie
- 2.4.1. Chirurgische Therapie
- 2.4.2. Adjuvante Strahlentherapie
- 2.4.3. Adjuvante medikamentöse (systemische) Therapien
- 2.4.4. Nebenwirkungen der Brustkrebstherapie
- 2.5. Folgen der Brustkrebserkrankung
- 2.5.1. Beeinträchtigungen auf physischer und funktioneller Ebene
- 2.5.2. Beeinträchtigungen auf psychischer, emotionaler und psychosozialer Ebene
- 2.6. Medizinische Nachsorge
- 2.7. Rehabilitation
- 2.7.1. Begriffsklärung
- 2.7.2. Ziele der Rehabilitation
- 3. Bewegung und Sport nach (Brust-)Krebs - allgemeine Grundlagen
- 3.1. Auswirkungen von Bewegungsmangel auf den Krankheitsverlauf
- 3.2. Begriffsbestimmungen
- 3.2.1. Bewegungstherapie
- 3.2.1.1. Physiotherapie
- 3.2.1.2. Sporttherapie
- 3.3. Bewegungstherapie in der Onkologie – die Rehabilitationskette
- 3.3.1. Akutklinik
- 3.3.2. Rehabilitationsklinik
- 3.3.3. Rehabilitationssport/ Krebssportgruppen
- 3.4. Ziele von Bewegung und Sport bei Brustkrebs
- 3.5. Spezielle Herausforderungen der Therapieplanung in der Onkologie
- 3.6. Kontraindikationen
- 4. Entwurf eines Ziel-Inhalts-Konzeptes
- 4.1. Wirksamkeit von Bewegungsinterventionen bei Brustkrebspatientinnen - wissenschaftliche Erkenntnisse
- 4.2. Ziele des Konzeptes
- 4.3. Exkurs: Das Konzept der Salutogenese in der sporttherapeutischen Arbeit
- 4.4. Allgemeine Grundlagen zum Training in der Rehabilitation
- 4.4.1. Belastungsnormative
- 4.4.2. Belastungssteuerung
- 4.4.3. Trainingsprinzipien
- 4.4.4. Regeneration
- 4.5. Methoden der bewegungsbezogenen Umsetzung
- 4.5.1. Training der Ausdauer
- 4.5.2. Training der Muskelkraft
- 4.5.3. Training der Beweglichkeit
- 4.5.4. Training der Koordination
- 4.5.5. Möglichkeiten der Umsetzung in die Praxis
- 4.5.6. Allgemeiner Aufbau einer Bewegungseinheit
- 4.6. Methoden der psychophysischen Regulation
- 4.6.1. Körpererfahrung
- 4.6.2. Entspannungsverfahren
- 4.7. Funktionen und Aufgaben des Bewegungstherapeuten
- 4.8. Vermittlung theoretischer Inhalte
- 4.9. Besonderheiten der Bewegungsintervention mit Brustkrebspatientinnen
- 4.10. Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht bewegungstherapeutische Ansätze in der Rehabilitation von Brustkrebspatientinnen. Ziel ist die Entwicklung eines erkenntnisgestützten Ziel-Inhalts-Konzeptes für die Bewegungtherapie in diesem Kontext.
- Medizinische Grundlagen von Brustkrebs
- Auswirkungen von Brustkrebs und dessen Therapie auf die Patientinnen
- Bewegungstherapie und Sport in der Onkologie
- Entwicklung eines Ziel-Inhalts-Konzeptes für die Bewegungstherapie
- Methoden der bewegungsbezogenen und psychophysischen Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 behandelt die medizinischen und allgemeinen Grundlagen von Brustkrebs, einschließlich Epidemiologie, Physiologie, Ätiologie, Therapie und deren Folgen für die Betroffenen. Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung von Bewegung und Sport in der Rehabilitation nach Brustkrebs, definiert relevante Begriffe und beschreibt die Rehabilitationskette. Kapitel 4 präsentiert den Entwurf eines Ziel-Inhalts-Konzeptes für eine bewegungstherapeutische Intervention, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und berücksichtigt die spezifischen Herausforderungen bei Brustkrebspatientinnen. Der Fokus liegt hier auf Zielen des Konzeptes, Trainingsgrundlagen und Methoden der Umsetzung.
Schlüsselwörter
Brustkrebs, Rehabilitation, Bewegungstherapie, Sporttherapie, Ziel-Inhalts-Konzept, Onkologie, psychophysische Regulation, Bewegungsintervention.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Bewegungstherapie bei Brustkrebs?
Bewegungstherapie dient in der Rehabilitation dazu, physische und psychische Folgen der Erkrankung und Therapie zu mindern und die Lebensqualität zu steigern.
Was ist das Ziel-Inhalts-Konzept dieser Arbeit?
Es ist ein Entwurf, der aus den Rehabilitationszielen konkrete Inhalte wie Ausdauer-, Kraft- und Koordinationstraining für Brustkrebspatientinnen ableitet.
Welche Wirkungen hat Sport auf den Krankheitsverlauf?
Sport wirkt Bewegungsmangel entgegen, verbessert die funktionelle Ebene und hilft bei der psychophysischen Regulation (z.B. Reduktion von Fatigue).
Gibt es Kontraindikationen für Bewegungstherapie?
Ja, die Arbeit thematisiert spezifische Kontraindikationen und Herausforderungen in der onkologischen Therapieplanung, die unbedingt beachtet werden müssen.
Was sind die methodischen Schwerpunkte des Trainings?
Schwerpunkte sind das Training von Ausdauer, Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordination sowie Entspannungsverfahren zur psychophysischen Regulation.
Welche Rolle spielt die Salutogenese in diesem Konzept?
Das Konzept der Salutogenese wird herangezogen, um die sporttherapeutische Arbeit auf die Förderung von Gesundheitsressourcen auszurichten.
- Quote paper
- Carolin Stiefel (Author), 2010, Bewegungstherapeutische Ansätze in der Rehabilitation von Brustkrebs - Entwurf eines erkenntnisgestützten Ziel-Inhalts-Konzeptes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181089