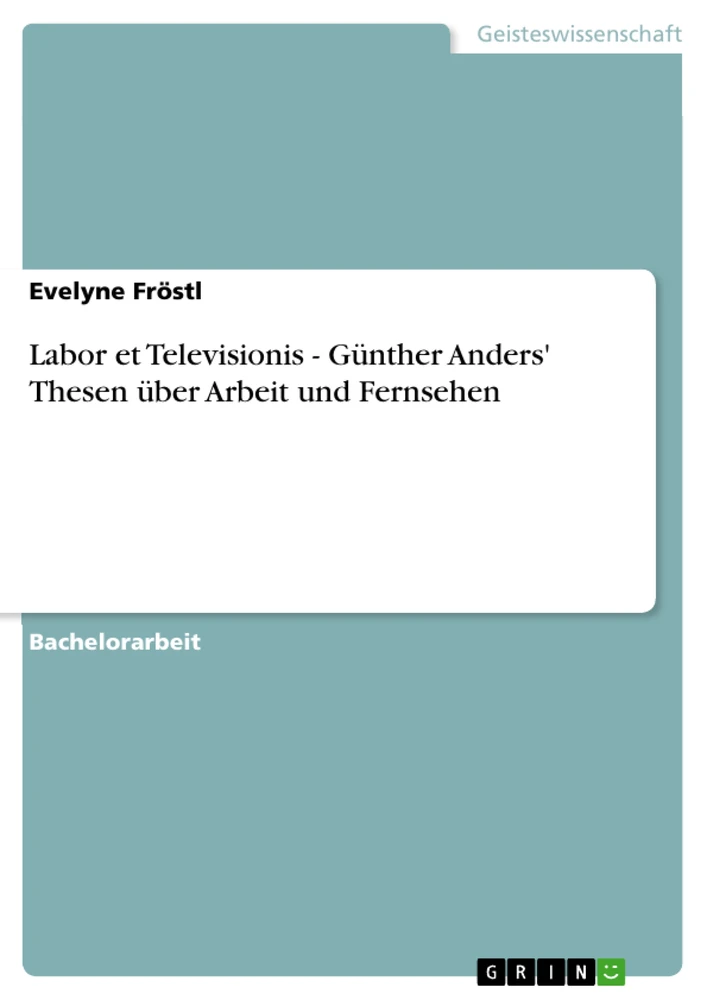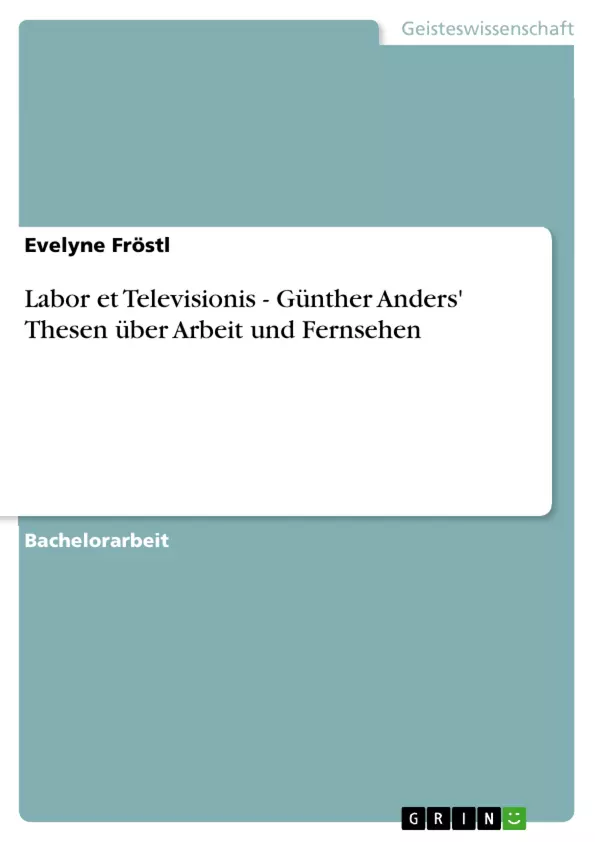Arbeit ist das halbe Leben. Seit der industriellen Revolution haben sich nsere Arbeitsbedingungen und unsere Tätigkeitsfelder stark verändert; aber auch die Art und Weise wie wir unsere Freizeit gestalten sieht heute anders aus als noch vor einigen Jahrzehnten.
Günther Anders (1902 – 1992) hat sich in seinem technikkritischen Denken nicht nur mit der industriellen Revolution und deren weit reichenden Folgen befasst, sondern auch das seiner Zeit neue Medium Fernsehen kritisch in den Blick genommen und in scharfsinniger – manchmal geradezu zynischer – Weise analysiert.
In dieser Bachelorarbeit soll der Versuch unternommen werden Zusammenhänge von Arbeit und Freizeit in der technikkritischen Philosophie von Günther Anders herauszuarbeiten und weiterführende Fragestellungen aufzuwerfen, sowie einige eigenständige Betrachtungen anzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort
- II. Arbeit und Entfremdung
- 1. Arbeitslosigkeit
- III. Freizeit
- 1. Die Angst vor dem Nichts
- 2. Die ins Haus gelieferte Welt
- 3. Die Verbiederung der Welt
- 3.1 Die drei Nebenwurzeln der Verbiederung
- 3.2 Die Hauptwurzel der Verbiederung
- IV. Rückfragen und Betrachtungen
- V. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Arbeit und Freizeit im technikkritischen Denken von Günther Anders. Sie analysiert die Folgen der Technisierung für die Arbeitswelt und die Gestaltung der Freizeit und stellt weiterführende Fragen sowie eigene Betrachtungen an.
- Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit im Kontext der industriellen Revolution
- Kritik am Einfluss des Fernsehens auf die Freizeitgestaltung
- Analyse der Verbiederung der Welt durch die moderne Technik
- Verhältnis von Arbeit und Muße in der modernen Gesellschaft
- Die Rolle der Technik bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Freizeitaktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in die Arbeit ein und erläutert den Begriff "Arbeit" im historischen Kontext. Kapitel II befasst sich mit dem Thema der Entfremdung, wobei die Gedanken von Karl Marx und Günther Anders im Hinblick auf die Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts betrachtet werden. Kapitel III widmet sich der Gestaltung der Freizeit im Kontext der technischen Entwicklungen. Es werden die Themen „Angst vor dem Nichts“, „Die ins Haus gelieferte Welt“ und „Die Verbiederung der Welt“ in ihrer Bedeutung für die Freizeitgestaltung untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Arbeit, Entfremdung, Freizeit, Technikkritik, Günther Anders, Karl Marx, Fernsehen, Verbiederung der Welt, Industrielle Revolution.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Thesen von Günther Anders über das Fernsehen?
Anders kritisiert das Fernsehen als Medium, das die Welt „ins Haus liefert“ und dadurch zu einer „Verbiederung“ und Entfremdung von der Realität führt.
Wie hängen Arbeit und Freizeit bei Günther Anders zusammen?
Anders sieht in der modernen Technik eine zunehmende Entfremdung in der Arbeit, die sich in einer passiven und technisierten Freizeitgestaltung (z.B. TV-Konsum) fortsetzt.
Was versteht Anders unter der „Verbiederung der Welt“?
Damit ist die Tendenz gemeint, durch Massenmedien alles Ferne und Fremde künstlich nah und vertraut erscheinen zu lassen, was die Tiefe der Erfahrung zerstört.
Welche Rolle spielt die industrielle Revolution in seiner Philosophie?
Die industrielle Revolution markiert für Anders den Beginn einer technologischen Entwicklung, die den Menschen zunehmend zum bloßen Bediener degradiert.
Warum thematisiert die Arbeit die „Angst vor dem Nichts“?
Dies bezieht sich auf die Leere, die entsteht, wenn Freizeit nicht mehr schöpferisch (Muße), sondern nur noch als passiver Konsum technischer Angebote erlebt wird.
- Quote paper
- Evelyne Fröstl (Author), 2011, Labor et Televisionis - Günther Anders' Thesen über Arbeit und Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181155