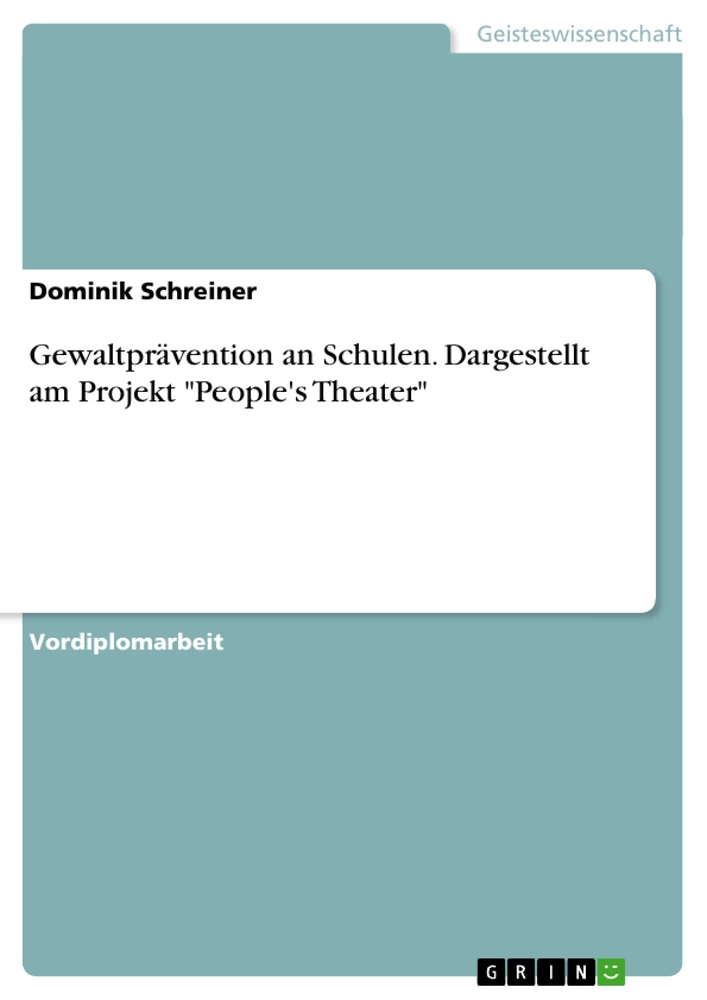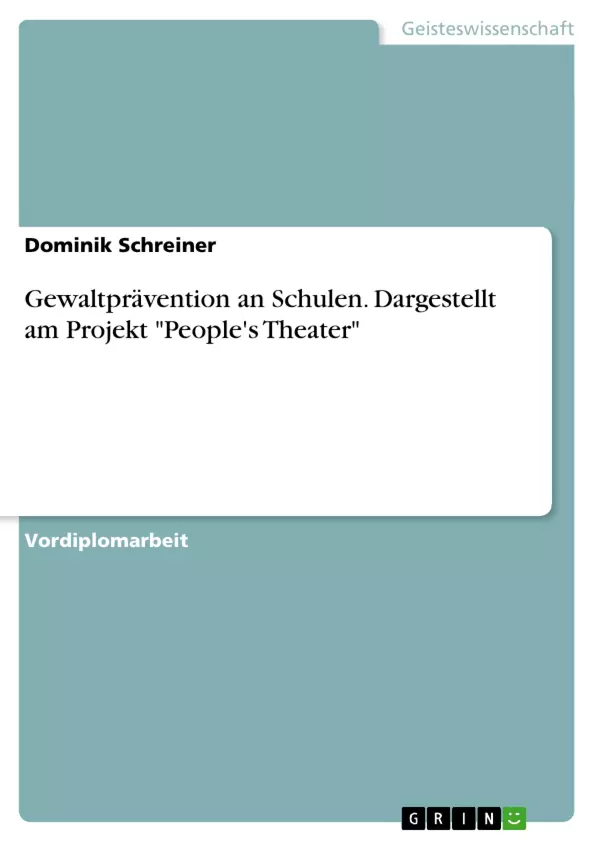Gewalt ist ein Phänomen, welches die Menschheit seit jeher begleitet hat. Sie „ist
allgegenwärtig und prägt die Geschichte der Menschheit. Sie findet in den verschiedensten
Ausprägungen statt“ (Varbelow 2000, S. 13). Mit dieser sehr allgemein gehaltenen
Feststellung hat Dirk Varbelow grob umrissen, wie gross das Ausmass ist, welches Gewalt
erreichen kann.
Die vorliegende Arbeit jedoch will nicht soweit gehen. Sie beschäftigt sich zunächst vielmehr
mit einer groben Darstellung von Gewalt an Schulen, wobei auf die verschiedenen Ursachen,
die Täter-Opfer-Problematik und die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt kurz
eingegangen wird. Speziell thematisiert wird hierbei auch Fremdenfeindlichkeit als Form von
Gewalt. Der Grund dafür ist wohl die weite Verbreitung des Rechtsextremismus in
Einwanderungsland Deutschland. Fremdenfeindlichkeit ist fast zu einem alltäglichen
Bestandteil des Lebens geworden. So habe ich mich entschlossen, diese spezielle Form von
Gewaltanwendung kurz separat zu thematisieren.
Den grössten Teil der Arbeit bildet die Gewaltprävention speziell an Schulen. Hierfür konnte
ich die Ausführungen von Lothar R. Martin über seine „Zwölf Grundformen der
Gewaltprävention“ verwenden, die meiner Ansicht nach eine gute Grundlage für
auszuführende Projekte bilden, weil sie nicht nur wiederum kurz auf die Ursachen von Gewalt
innerhalb und ausserhalb des schulischen Rahmens eingehen, sondern auch theoretische
Ansätze zur Prävention als Schlussfolgerung daraus anbieten. Ferner werden an konkreten
Beispielen und Vorschlägen auch die praktische Umsetzung dargestellt.
Beim letzten Teil der Arbeit über das Projekt „People’s Theater“ in Offenbach soll eine
konkrete und sehr besondere Art und Weise vorgestellt werden, wie Gewaltprävention an
Schulen mit Elementen des Theaters aussehen kann. Ich hoffe vor allem, dem Leser das
Projekt näherzubringen, weil es indirekt und vielleicht unbeabsichtigt an die zwölf
Grundformen der Gewaltprävention angelehnt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewalt an Schulen
- Gewaltprävention
- Die zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin
- Grundform 1: „Raum geben - Schulleben ermöglichen“
- Grundform 2: „Frustration abbauen – Regeln achten – Fairness üben in Sport und Spiel“
- Grundform 3: „Miteinander reden - Einander verstehen“
- Grundform 4: „Interagieren - Identität fördern“
- Grundform 5: „Medienkonsum - Durch Medien lernen“
- Grundform 6: „Werte bilden - Moralisch handeln“
- Grundform 7: „Projekte durchführen – Lernen durch tun“
- Grundform 8: „Gemeinschaft fördern - Gemeinsinn entwickeln“
- Grundform 9: „Konflikte bewältigen – Konfliktfähig werden“
- Grundform 10: „Mit Tätern umgehen - Gewalt entmachten“
- Grundform 11: „Kooperieren – Vernetzen“
- Grundform 12: „Menschen und Schöpfung achten - In Würde leben“
- Das gewaltpräventive, soziale Projekt „People's Theater“
- Resonanz und Erfahrungen an den Schulen über und von „People's Theater“
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gewaltprävention an Schulen, wobei der Fokus auf dem Projekt „People's Theater“ liegt. Ziel ist es, verschiedene Ansätze der Gewaltprävention zu beleuchten und deren praktische Umsetzung anhand des genannten Theaterprojekts zu veranschaulichen.
- Gewalt an Schulen und deren Ursachen
- Fremdenfeindlichkeit als Form von Gewalt
- Zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin
- Das Projekt „People's Theater“ als Beispiel für gewaltpräventive Maßnahmen
- Erfahrungen und Resonanz des „People's Theater“-Projekts an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Bedeutung des Themas Gewaltprävention an Schulen und benennt die Schwerpunkte der Arbeit. Sie führt in die Thematik der Gewalt an Schulen ein, hebt die Problematik von Fremdenfeindlichkeit hervor und kündigt die detailliertere Auseinandersetzung mit den zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin sowie die Präsentation des „People's Theater“-Projekts an. Der Bezug zu Varbelow (2000) unterstreicht die allgemeine Verbreitung von Gewalt als gesellschaftliches Phänomen.
Gewalt an Schulen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Formen von Gewalt an Schulen, einschließlich der Ursachen und der Täter-Opfer-Dynamik. Besonderes Augenmerk wird auf Fremdenfeindlichkeit als weit verbreitete Form von Gewalt in der multikulturellen Gesellschaft Deutschlands gelegt. Die Ausführungen dienen als Grundlage für die spätere Betrachtung von Präventionsmaßnahmen.
Gewaltprävention: Dieses Kapitel legt den Fokus auf theoretische Ansätze der Gewaltprävention. Es werden die zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin detailliert vorgestellt und analysiert. Die Ausführungen bieten eine systematische Darstellung von Präventionsstrategien und bilden die theoretische Basis für die spätere Evaluierung des „People's Theater“-Projekts.
Das gewaltpräventive, soziale Projekt „People's Theater“: Dieses Kapitel präsentiert das „People's Theater“-Projekt in Offenbach als ein konkretes Beispiel für gewaltpräventive Arbeit an Schulen. Es beschreibt das Ziel und Konzept der Show, und analysiert, wie das Projekt indirekt die zwölf Grundformen der Gewaltprävention aufgreift und umsetzt. Die Ausführungen bieten einen detaillierten Einblick in die praktische Anwendung von Gewaltpräventionsmaßnahmen.
Resonanz und Erfahrungen an den Schulen über und von „People's Theater“: Dieses Kapitel evaluiert die Resonanz und Erfahrungen des „People's Theater“-Projekts an den Schulen. Es analysiert den Erfolg des Projekts und zieht Schlussfolgerungen für die zukünftige Umsetzung gewaltpräventiver Maßnahmen. Dieser Teil bietet eine kritische Reflexion der Praxiserfahrungen.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Schulen, Fremdenfeindlichkeit, Lothar R. Martin, „People's Theater“, Theaterpädagogik, Konfliktlösung, Soziales Lernen, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewaltprävention an Schulen - Das Projekt "People's Theater"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gewaltprävention an Schulen, insbesondere das Projekt „People’s Theater“. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze der Gewaltprävention, untersucht deren praktische Umsetzung im „People’s Theater“-Projekt und evaluiert dessen Resonanz an Schulen. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Gewalt an Schulen, Gewaltprävention (inkl. der zwölf Grundformen nach Lothar R. Martin), eine detaillierte Darstellung des „People’s Theater“-Projekts, eine Evaluierung der Projekterfahrungen und einen Ausblick.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Gewalt an Schulen und deren Ursachen, Fremdenfeindlichkeit als Form von Gewalt, die zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin, das Projekt „People’s Theater“ als Beispiel für gewaltpräventive Maßnahmen und die Erfahrungen und Resonanz dieses Projekts an Schulen.
Was sind die zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin?
Die Arbeit beschreibt detailliert die zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin. Diese umfassen beispielsweise „Raum geben - Schulleben ermöglichen“, „Frustration abbauen“, „Miteinander reden“, „Werte bilden“, „Konflikte bewältigen“ und „Kooperieren – Vernetzen“. Die einzelnen Grundformen werden im Kontext des „People’s Theater“-Projekts analysiert.
Was ist das „People’s Theater“-Projekt?
Das „People’s Theater“-Projekt in Offenbach ist ein soziales Projekt zur Gewaltprävention an Schulen. Die Arbeit beschreibt dessen Konzept und Zielsetzung und analysiert, wie das Projekt die zwölf Grundformen der Gewaltprävention nach Lothar R. Martin indirekt aufgreift und umsetzt. Es wird detailliert dargestellt, wie das Projekt in der Praxis funktioniert.
Wie wird das „People’s Theater“-Projekt evaluiert?
Die Arbeit evaluiert das „People’s Theater“-Projekt anhand der Resonanz und Erfahrungen an den Schulen. Sie analysiert den Erfolg des Projekts und zieht Schlussfolgerungen für die zukünftige Umsetzung gewaltpräventiver Maßnahmen. Die Evaluierung basiert auf einer kritischen Reflexion der Praxiserfahrungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gewaltprävention, Schulen, Fremdenfeindlichkeit, Lothar R. Martin, „People’s Theater“, Theaterpädagogik, Konfliktlösung, Soziales Lernen, Integration.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Gewaltprävention an Schulen mit dem Fokus auf das Projekt „People’s Theater“. Ziel ist es, verschiedene Ansätze der Gewaltprävention zu beleuchten und deren praktische Umsetzung anhand des Theaterprojekts zu veranschaulichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Schulsozialarbeiter, Mitarbeiter in der Jugendhilfe, sowie für alle, die sich mit Gewaltprävention an Schulen auseinandersetzen. Sie bietet praktische Einblicke und theoretische Grundlagen für die Entwicklung und Umsetzung von Präventionsprogrammen.
- Citation du texte
- Dominik Schreiner (Auteur), 2003, Gewaltprävention an Schulen. Dargestellt am Projekt "People's Theater", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18118