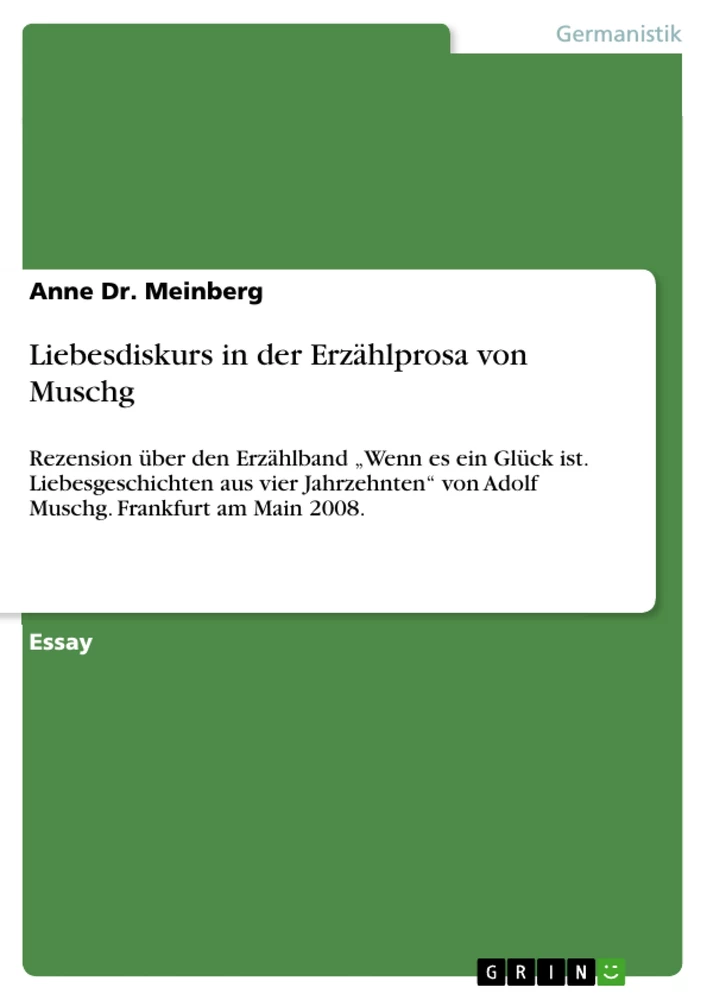Der Schweizer Autor Adolf Muschg ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Gegenwartsautoren. Seine Liebesgeschichten berühren und befremden zugleich, weil die Protagonisten seiner Erzählungen ungewöhnlichen Handlungsmustern folgen, um die Liebe zu verwirklichen oder ihr auszuweichen. In dem vorliegenden Essay sind einige der wichtigsten Erzählungen aus Muschgs Prosa kritisch kommentiert und analysiert. Eine umfassende wissenschaftliche Auseinandersetzung zu diesem Thema findet sich in meiner Dissertation: "Von der Liebe will ich erzählen". Bouvier-Verlag 2007 (ISBN 978-3-416-03204-9)
You will find a text preview here soon.
Excerpt out of 6 pages
- scroll top
- Quote paper
- Doktor der Philosophie Anne Dr. Meinberg (Author), 2008, Liebesdiskurs in der Erzählprosa von Muschg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181200
Look inside the ebook