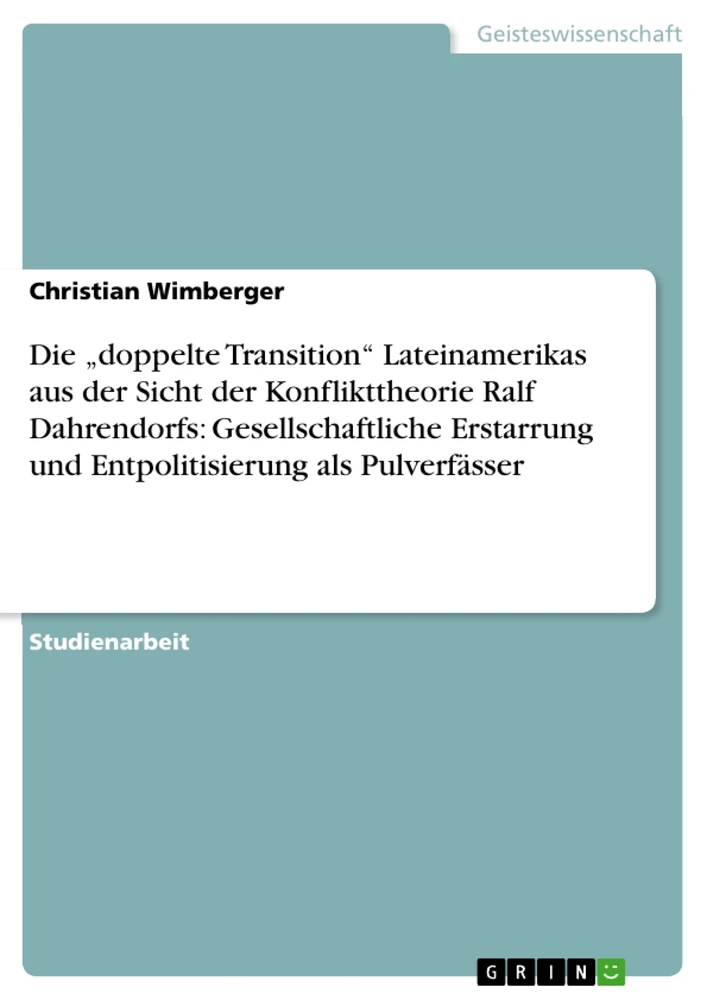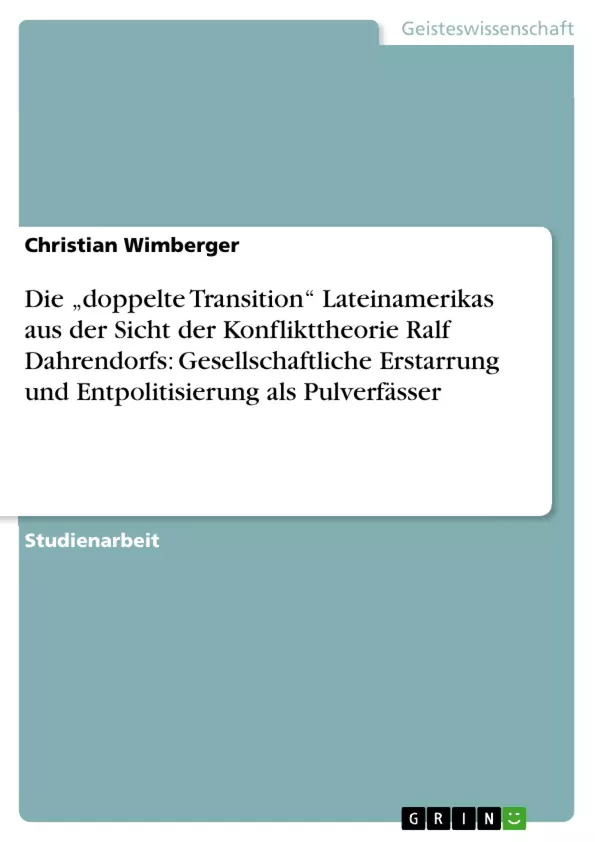Trotz der augenscheinlichen institutionellen Stabilität der im Zuge der „Dritten Welle der Demokratisierung“ entstanden Demokratien in Lateinamerika, verschärfte die „doppelte Transition“ in den meisten Ländern bestimmte soziopolitische Konfliktpotentiale. Diese Konfliktpotentiale entluden sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts in Protestbewegungen und führten schließlich am Anfang des neuen Jahrtausends zum Wahlsieg der „Neuen Linken“ in Ländern wie Venezuela, Bolivien, Ecuador und Nicaragua. Der Autor analysiert die strukturellen Konfliktkonstellationen der lateinamerikanischen Transitionsländer durch das Objektiv der Konflikttheorie Ralf Dahrendorfs und zeigt, wie Prozesse gesellschaftlicher Erstarrung und Entpolitisierung zu „Pulverfässern“ für die Stabilität der neuen Demokratien wurden. Im Fazit spricht sich der Autor für eine soziologische Analyse der sozialen und politischen Realität Lateinamerikas statt einer rein institutionalistischen Herangehensweise, die viele politikwissenschaftliche Arbeiten auszeichnet, aus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Konflikttheorie Ralf Dahrendorfs
- Die doppelte Transition Lateinamerikas: Entpolitisierung und gesellschaftliche Erstarrung.
- Was kann die Konflikttheorie Dahrendorfs über die soziopolitischen Ordnungen Lateinamerikas aussagen?
- Fazit: Vorteile einer soziologischen Analyse der soziopolitischen Realität Lateinamerikas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gründe für die Defizite der Demokratisierungsprozesse und der aktuellen politischen Ordnungen Lateinamerikas aus der Perspektive der Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie die „doppelte Transition“ – die politische Liberalisierung und die wirtschaftliche Öffnung – zu Entpolitisierung, gesellschaftlicher Erstarrung und schließlich zu neopopulistischen Regimen geführt hat. Die Arbeit beleuchtet dabei die Rolle von sozialer und wirtschaftlicher Exklusion sowie von autoritären Regierungspraktiken.
- Die Konflikttheorie Ralf Dahrendorfs und ihre Relevanz für die Analyse politischer Ordnungen
- Die "doppelte Transition" in Lateinamerika: Politische Liberalisierung und wirtschaftliche Öffnung
- Entpolitisierung und gesellschaftliche Erstarrung als Folge der "doppelten Transition"
- Die Herausforderungen der Demokratie in Lateinamerika: Soziale und wirtschaftliche Exklusion
- Der Aufstieg des Neopopulismus und seine Auswirkungen auf die politische Landschaft Lateinamerikas
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht die Defizite der Demokratisierungsprozesse in Lateinamerika und setzt diese in den Kontext der „doppelten Transition“ – der politischen Liberalisierung und der wirtschaftlichen Öffnung. Sie stellt die Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf als Analyseinstrument vor und beleuchtet die Bedeutung von sozialen Konflikten für gesellschaftlichen Wandel.
- Die Konflikttheorie Ralf Dahrendorfs: Dieses Kapitel skizziert die zentralen Elemente der Konflikttheorie Dahrendorfs, die auf einer kritischen Rezeption und Verallgemeinerung der Klassentheorie von Karl Marx basiert. Es beleuchtet die Rolle von sozialen Konflikten als Triebfeder gesellschaftlicher Entwicklung und betont die Bedeutung der Institutionalisierung von Konflikten für eine stabile Gesellschaft.
- Die doppelte Transition Lateinamerikas: Entpolitisierung und gesellschaftliche Erstarrung: Dieses Kapitel untersucht die politische Liberalisierung und die wirtschaftliche Öffnung in Lateinamerika, die zu einer Entpolitisierung und gesellschaftlichen Erstarrung geführt haben. Es analysiert die Folgen der Übertragung ökonomischer und sozialer Fragen auf den Markt und die Rolle der technokratischen Bürokratie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf, der "doppelten Transition" in Lateinamerika, Entpolitisierung, gesellschaftlicher Erstarrung, sozialer und wirtschaftlicher Exklusion, neopopulistischen Regimen, Demokratiedefiziten, und der Rolle der politischen Kultur in Lateinamerika.
- Quote paper
- Christian Wimberger (Author), 2011, Die „doppelte Transition“ Lateinamerikas aus der Sicht der Konflikttheorie Ralf Dahrendorfs: Gesellschaftliche Erstarrung und Entpolitisierung als Pulverfässer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181203