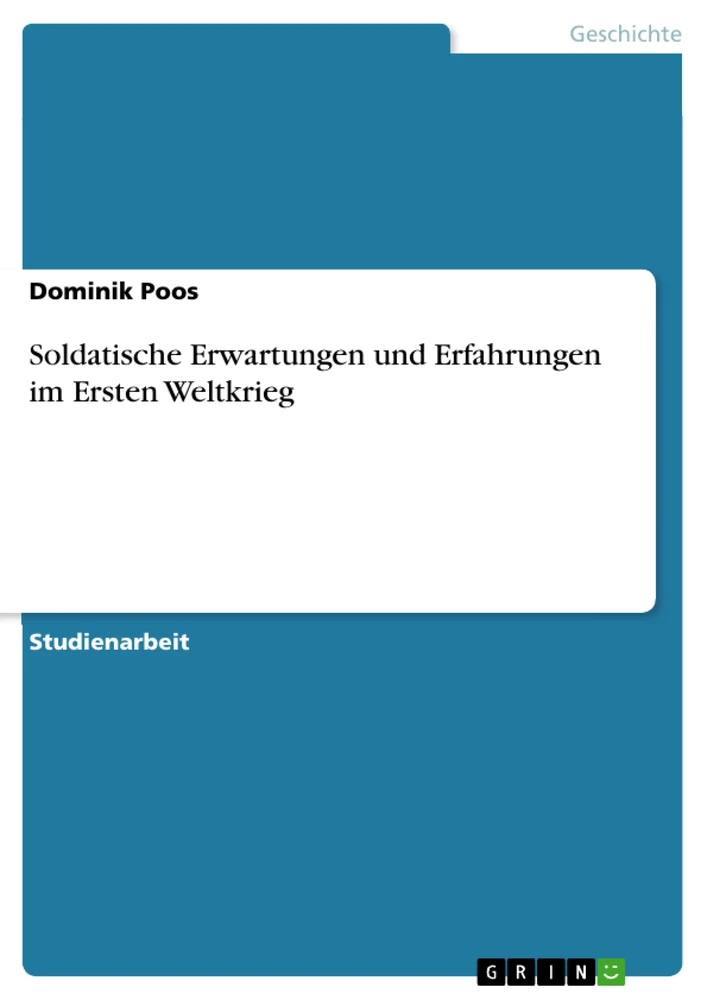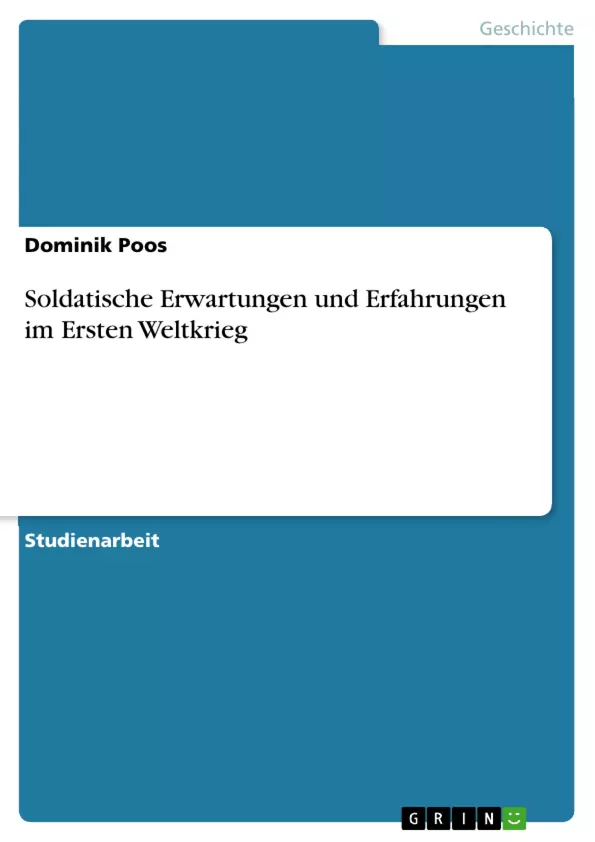Der Erste Weltkrieg hat sich bis heute als »europäische Tragödie« in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Die vollkommene Ausrichtung der Wirtschaft auf den Krieg, die neuartige Maschinisierung der Kampfhandlungen und das damit einhergehende, zuvor ungeahnte Ausmaß an Toten, sowie die menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Soldaten - all diese Faktoren tragen zum allgemeinen Verständnis des Weltkriegs bei. Dem entgegen steht der Begriff des »Augusterlebnisses«, der nationale Kriegsbegeisterung und allgemeinen Rauschzustand zu Beginn des Krieges beinhaltet. Kollektiv wird dies auch als »Geist von 1914« bezeichnet.
»Der Krieg hatte seine Krallen gezeigt und die gemütliche Maske abgeworfen. Das war so rätselhaft, so unpersönlich. Kaum, daß man dabei an den Feind dachte, dieses geheimnisvolle, tückische Wesen irgendwo dahinten. Das völlig außerhalb der Erfahrung liegende Ereignis machte einen so starken Eindruck, daß es Mühe kostete, die Zusammenhänge zu begreifen. Es war eine gespenstische Erscheinung im hellen Mittagslicht.«
Dieses Zitat des Schriftstellers Ernst Jünger, welcher während des Weltkriegs zum Offizier befördert wurde, zeigt exemplarisch die plötzliche Ernüchterung der Soldaten, als sie sich erstmals mit dem Alltag und der Realität des Kriegs konfrontiert sahen. Der Widerspruch zwischen Erwartungen und Erfahrungen machte den Kriegsalltag, der von Tod, Leid und Entmenschlichung geprägt war, für die Soldaten nahezu unerträglich. Kriegserfahrungen und Lebensumstände wurden von Frontkämpfern in Erfahrungsberichten, Briefen oder Tagebüchern ausführlich beschrieben und von diversen Historikern in ihren Forschungen thematisiert. Unzählige Arbeiten von Historikern wie Gerhard Hirschfeld, Modris Eksteins, Anne Lipp oder Benjamin Ziemann zeugen davon, dass sich die soldatischen Front- und Kriegserfahrungen als fruchtbares Forschungsfeld erwiesen haben. Fest steht somit die Bedeutung der Auseinandersetzung mit diesem »Krieg des kleinen Mannes«.
Doch wie weit ging die Schere zwischen den soldatischen Kriegserwartungen und dem was sie erfuhren tatsächlich auseinander? Ist etwa dem Bild des Soldaten, der unwissend und voller Begeisterung aus der Kaserne in den Tod marschierte zuzustimmen?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Quellenlage
- II.1. Feldpost
- II.2. Feldzeitungen
- III. Erwartungen und Reaktionen auf den Krieg
- IV. Erfahrungen und Reaktionen...
- V. Schlussbetrachtung
- VI. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Kriegserwartungen und -erfahrungen deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg. Sie untersucht die Diskrepanz zwischen dem idealisierten Bild vom Krieg und der brutalen Realität der Front und analysiert, wie diese Diskrepanz in Briefen, Tagebüchern und Feldzeitungen zum Ausdruck kommt.
- Die Bedeutung von Feldpostbriefen und Feldzeitungen als Quellen für die Erforschung der Kriegserfahrungen
- Das »Augusterlebnis« als Ausdruck nationaler Kriegsbegeisterung und die Veränderung der Kriegserwartungen im Verlauf des Krieges
- Der Umgang mit dem Tod im Krieg und die Auswirkungen auf die psychische Verfassung der Soldaten
- Die unterschiedlichen Erfahrungen von Soldaten in verschiedenen Bevölkerungsgruppen
- Die Rolle von Propaganda und Zensur in der Konstruktion der öffentlichen Meinung über den Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Erläuterung der Quellenlage, wobei der Fokus auf Feldpostbriefen und Feldzeitungen liegt. Diese Quellen bieten einen einzigartigen Einblick in die Gedankenwelt der Soldaten, aber auch in die alltäglichen Lebensbedingungen an der Front. Das Kapitel beleuchtet den Wert dieser Quellen und ihre Bedeutung für die Erforschung der Kriegserwartungen und -erfahrungen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem »Augusterlebnis« als Ausdruck nationaler Kriegsbegeisterung. Anhand von Quellenmaterialien wird gezeigt, wie sich die Kriegserwartungen im Laufe des Krieges veränderten und wie die Soldaten mit den brutalen Realitäten der Front konfrontiert wurden. Das Kapitel beleuchtet die Diskrepanz zwischen den idealisierten Vorstellungen und den tatsächlichen Kriegserfahrungen.
In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Aspekte der Kriegserfahrungen, wie der Umgang mit dem Tod, die psychischen Belastungen und die unterschiedlichen Lebensumstände der Soldaten, detailliert dargestellt. Anhand von Beispielen aus Feldpostbriefen und Feldzeitungen werden die individuellen Erfahrungen und Reaktionen der Soldaten auf die Kriegswirklichkeit verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Feldpost, Feldzeitungen, Kriegserwartungen, Kriegserfahrungen, Augusterlebnis, Tod, psychische Belastungen, Frontalltag, Propaganda, Zensur, individuelle Erfahrungen.
- Quote paper
- Dominik Poos (Author), 2011, Soldatische Erwartungen und Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181213