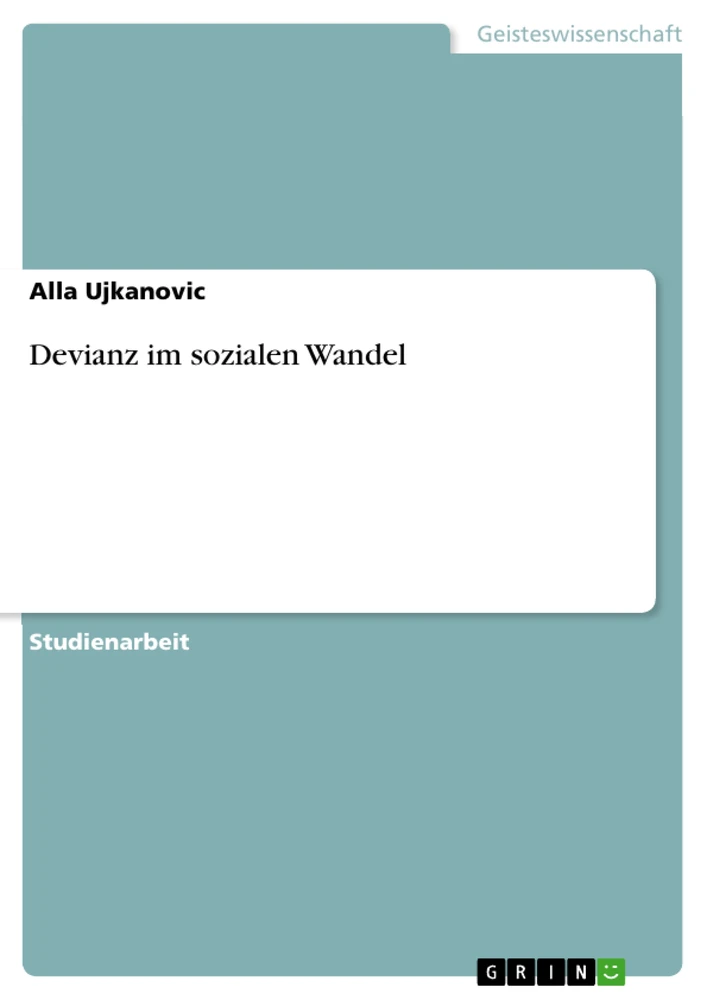Im Laufe des Seminar „Devianz und Sozialverhalten“ haben wir uns unter anderem mit
sozialen Normen, abweichendem Verhalten sowie Sexualität beschäftigt. Diese Themen
sollen in dieser Hausarbeit nochmals aufgeführt und in Verbindung gebracht werden –
allerdings unter dem Einbezug des sozialen Wandels. Dieser spielt deshalb eine solch
wichtige Rolle, weil sich durch ihn Menschen, Einstellungen und
Normalitätsvorstellungen ändern. Lebenssituationen, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt undenkbar waren, können zu einem anderen Zeitpunkt alltäglich werden.
Bildungswege, die in einem bestimmten Augenblick nur für einige Bevölkerungsschichten
zugänglich waren, können plötzlich für alle Menschen zugänglich gemacht
werden. Rollenverteilungen, die selbstverständlich zu sein schienen, werden
angezweifelt und geändert.
Das Ziel dieser Hausarbeit liegt darin, einige dieser Veränderungen zu beschreiben und
herauszufinden, warum sie stattfinden. Außerdem soll geklärt werden, ob die
Menschheit den sozialen Wandel überhaupt benötigt. Die Arbeit soll den Leser zum
Nachdenken anregen, vor allem darüber, warum sich Dinge verändern und wie die
Menschen die Veränderungen sehen sollen- positiv oder negativ. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des sozialen Wandels
- Grundtrends sozialen Wandels
- Funktion des sozialen Wandels
- Devianz im sozialen Wandel
- Geschlechter
- Devianz am Beispiel von Homosexualität
- Antibabypille
- Kindesmissbrauch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Verbindung zwischen sozialem Wandel und Devianz. Ziel ist es, zu beschreiben, wie gesellschaftliche Veränderungen das Verständnis von abweichendem Verhalten beeinflussen und warum solche Veränderungen stattfinden. Außerdem soll die Notwendigkeit des sozialen Wandels und seine Wahrnehmung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.
- Der Einfluss von sozialen Normen und abweichendem Verhalten
- Die Rolle des sozialen Wandels in der Entwicklung von Normalitätsvorstellungen
- Die Auswirkungen von sozialen Veränderungen auf die Wahrnehmung von Devianz
- Die Verbindung zwischen sozialem Wandel und der Entwicklung von Lebensentwürfen
- Die Notwendigkeit und die Wahrnehmung des sozialen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung des sozialen Wandels im Kontext von Normen, abweichendem Verhalten und Sexualität.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Definition des sozialen Wandels und analysiert die Grundtrends, die ihn prägen. Es werden auch verschiedene Theorien und Definitionen zum Wandelprozess diskutiert, um das Verständnis für die Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen zu vertiefen.
Das dritte Kapitel untersucht die Veränderung der Devianz im Wandel der Zeit und betrachtet die Bedeutung von Geschlechterrollen, Homosexualität, der Antibabypille und Kindesmissbrauch im Zusammenhang mit sozialen Veränderungen.
Schlüsselwörter
Soziale Normen, abweichendes Verhalten, sozialer Wandel, gesellschaftliche Strukturen, Normalitätsvorstellungen, Devianz, Geschlechterrollen, Homosexualität, Antibabypille, Kindesmissbrauch, Modernisierung, Lebensentwürfe.
- Citation du texte
- Alla Ujkanovic (Auteur), 2011, Devianz im sozialen Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181219