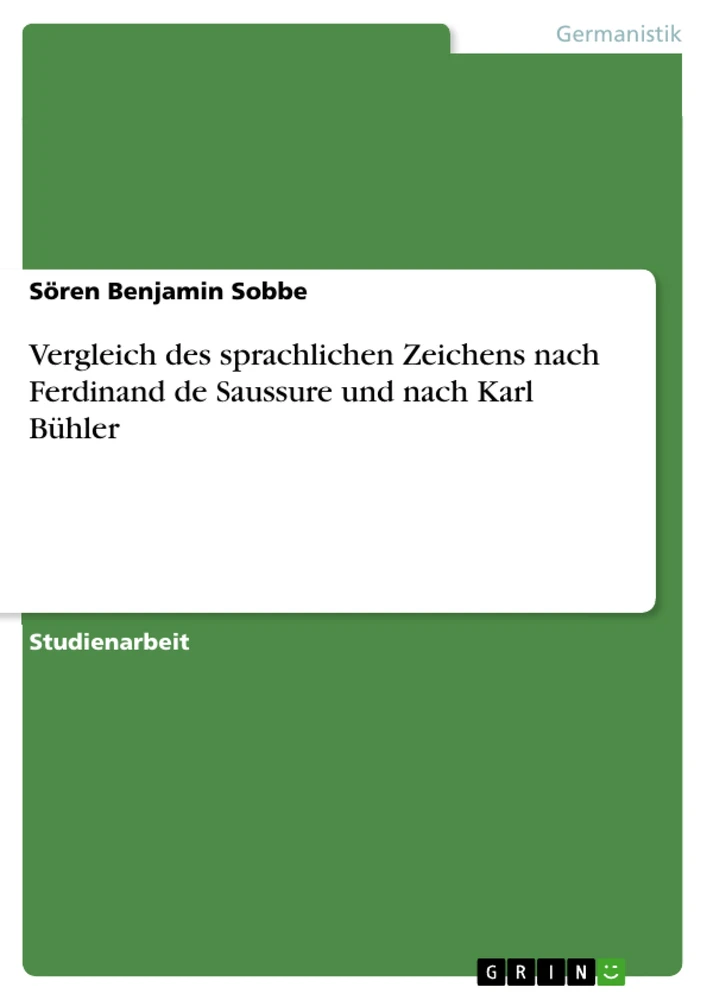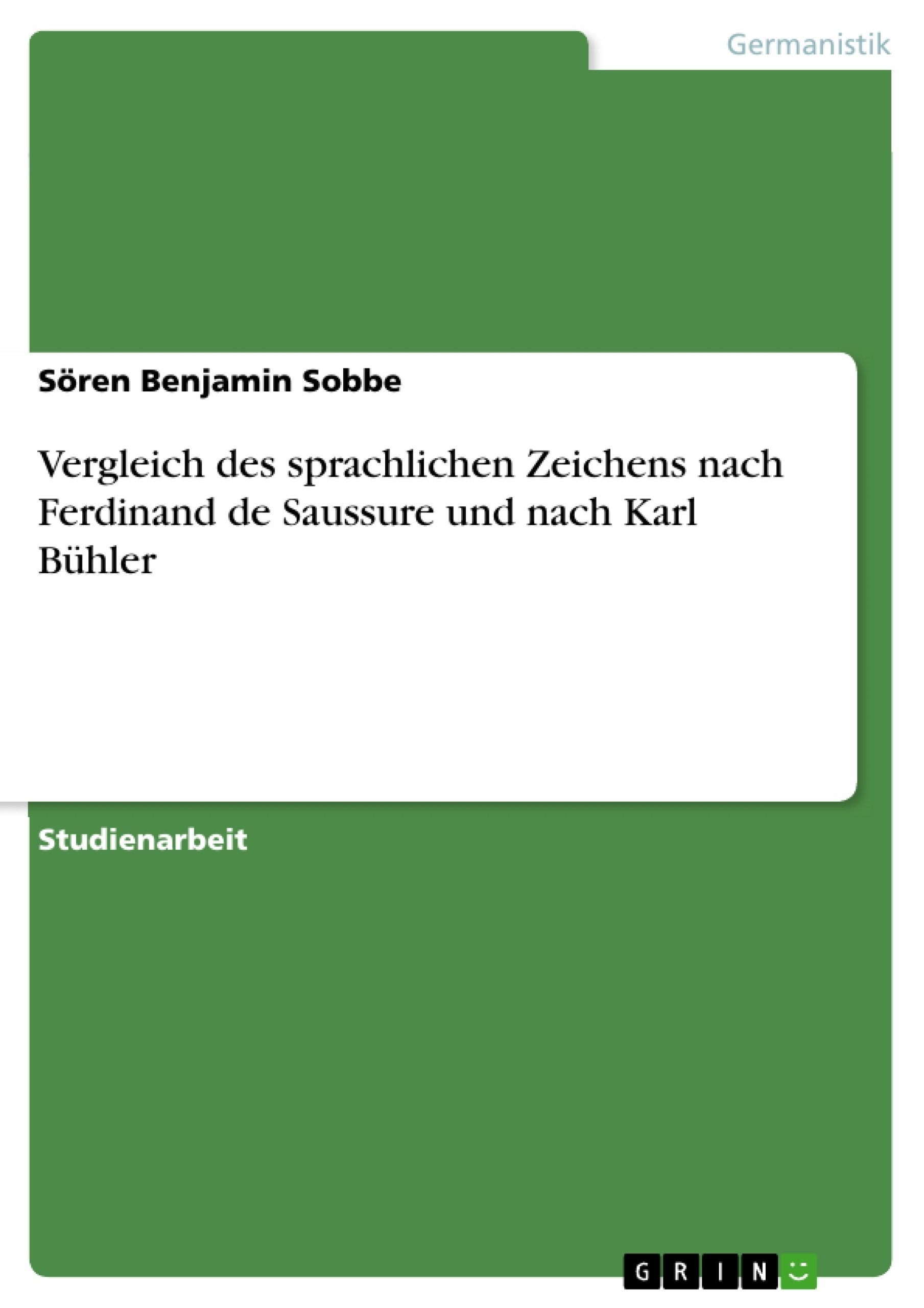Gegenstand dieser Arbeit ist der Vergleich des Zeichenmodells von Ferdinand de Saussure mit dem sogenannten Organonmodell von Karl Bühler. Dazu werden die beiden Zeichenmodelle genau beschrieben und als Grundlage die Definition beider Sprachwissenschaftler von Sprache dargestellt, denn ohne die wäre das sprachliche Zeichen gar nicht erst zu erklären. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Modelle werden aufgezeigt und es wird erklärt, inwiefern sich die beiden Wissenschaftler beeinflusst haben.
Dieses Thema ist besonders interessant, weil Ferdinand de Saussure und Karl Bühler äußerst bedeutsame und vielzitierte Linguisten sind, deren Theorien oftmals durch Auszüge ihrer prominentesten Passagen bekannt sind, aber kaum in Gänze wahrgenommen werden.
Diese Arbeit gliedert sich in drei Teile. Zuerst wird das Zeichenmodell Saussures erklärt. Dieser Teil orientiert sich am französischen Originaltext des Cours de linguistique générale, besonders wegen der präziseren Begrifflich-keiten, sowie an seiner deutschen Übersetzung. Die für Saussure wichtigen Aspekte des sprachlichen Zeichens werden in einzelnen Unterpunkten dargelegt. Dann folgt eine Beschreibung des Organonmodells anhand von Karl Bühlers Sprachtheorie. Weil dieses Modell sehr komplex und umfangreich ist, füge ich zur Orientierung die Abbildung des Modells in diesem Kapitel ein. Die Definition von Sprache nach Bühler wird im Unterpunkt „Vierfelderschema“ erklärt, indem ich eine auf Bühlers Abbildung davon basierende Tabelle als Grundlage der Erläuterung verwende. Schließlich folgt der vergleichende Teil, in dem zuerst die differenzierten Definitionen von Sprache als essenzielle Begründung für Unterschiede zwischen den Zeichenmodellen verglichen werden. Dann werden die wichtigsten Aspekte der Zeichen und Zeichenmodelle der beiden Sprachwissenschaftler einander gegenübergestellt. Dieser Teil der Arbeit beruht besonders auf den umfangreichen Untersuchungsergebnissen von Konrad Koerner und Rolf Müller. Der letzte Teil und gleichzeitig die gesamte Arbeit schließt mit einer kurzen Schlussfolgerung, in der nicht nochmals alle Untersuchungsergebnisse des Vergleichs zusammengefasst werden sollen, sondern die als konkreter Erklärungsansatz für die Unterschiede zwischen Saussures und Bühlers Theorien fungiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das sprachliche Zeichen nach Ferdinand de Saussure
- Definition von Sprache
- Definition des sprachlichen Zeichens
- Arbitrarität und Linearität
- Innere Nichtigkeit
- Unveränderlichkeit und Veränderlichkeit
- Kreislauf des Sprechens
- Das sprachliche Zeichen nach Karl Bühler
- Organonmodell
- Zeichennatur der Sprache
- Vierfelderschema
- Vergleich der Zeichenmodelle
- Sprache als System
- Zeichen und Zeichenmodell
- Kurze Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit vergleicht das Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure mit dem Organonmodell von Karl Bühler. Dabei werden die beiden Zeichenmodelle detailliert beschrieben, und die Definitionen von Sprache beider Sprachwissenschaftler dargestellt, da diese die Grundlage für die Erklärung des sprachlichen Zeichens bilden.
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Modelle werden aufgezeigt.
- Es wird untersucht, inwiefern sich die beiden Wissenschaftler gegenseitig beeinflusst haben.
- Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Theorien von Ferdinand de Saussure und Karl Bühler für die Linguistik.
- Die Arbeit zeigt die Relevanz der Modelle für das Verständnis der Sprachstruktur und -funktion.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor: den Vergleich der Zeichenmodelle von Ferdinand de Saussure und Karl Bühler. Sie erläutert die Relevanz des Themas und beschreibt die Gliederung der Arbeit.
Das sprachliche Zeichen nach Ferdinand de Saussure
Dieses Kapitel beschreibt Saussures Definition des sprachlichen Zeichens. Dabei werden zunächst seine Definition von Sprache als „langue“ im Gegensatz zur „parole“ erläutert, und die beiden Seiten des Zeichens, „Sinn“ und „Lautbild“ (oder „Vorstellung“ und „Lautbild“) vorgestellt. Die Kapitel behandelt außerdem die Prinzipien der Arbitrarität und Linearität des Zeichens.
Das sprachliche Zeichen nach Karl Bühler
Dieses Kapitel befasst sich mit Bühlers Organonmodell und erklärt seine Definition von Sprache als Werkzeug zur Kommunikation. Das Kapitel stellt die Zeichennatur der Sprache und das Vierfelderschema von Bühler vor.
Vergleich der Zeichenmodelle
Dieses Kapitel vergleicht die Definitionen von Sprache und die jeweiligen Zeichenmodelle von Saussure und Bühler. Es zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Ansätze und analysiert die Bedeutung der Modelle für das Verständnis von Sprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Sprachzeichen, Sprachtheorie, Ferdinand de Saussure, Karl Bühler, Organonmodell, langue, parole, Arbitrarität, Linearität, Zeichennatur, Vierfelderschema, Vergleichende Sprachwissenschaft.
- Quote paper
- Sören Benjamin Sobbe (Author), 2009, Vergleich des sprachlichen Zeichens nach Ferdinand de Saussure und nach Karl Bühler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181297