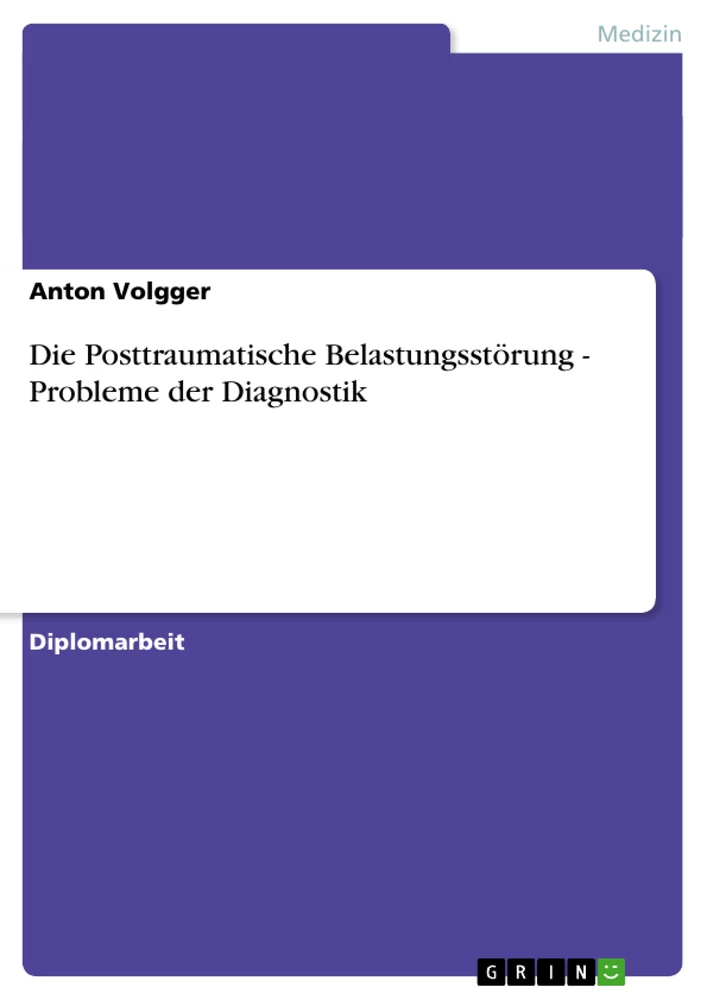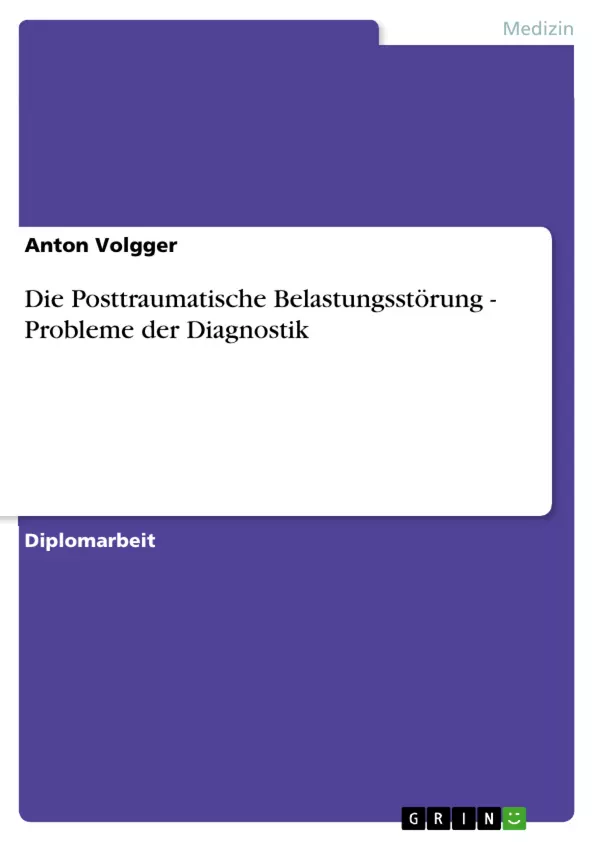Die Diplomarbeit entwirft zunächst einen allgemeinen Überblick über die psychiatrische Erkrankung der Posttraumatischen Belastungs-störung (PTBS engl. PTSD) im Sinne der Definition nach ICD - 10 und DSM – IV, beschreibt den Stand der Literatur nach Ursachen und Verlauf, Risikofaktoren, Prädiktoren sowie Komorbidität des Krankheitsbildes.
Schwerpunkt der Arbeit ist die kritische Analyse und Aufarbeitung der derzeitigen Diagnostik; als Beispiel zur Analyse von in publizierten Studien üblichen Diagnosepraktiken, dient dabei der „Harvard Trauma Questionnaire“ (HTQ), das derzeit wichtigste interkulturell eingesetzte valide und sensitive Diagnoseinstrument. Dieses wurde entwickelt, um Folter, Trauma und die Erkrankung der PTBS bei Flüchtlingen in Interview- oder Fragebogenform, zu erfassen; dieser wird daher detailliert vorgestellt und besprochen. Im Rahmen einer umfassenden Literaturecherche wurde eine Auswertungsmatrix entwickelt und eine aus Standardliteraturdatenbanken gezogene Stichprobe publizierter Studien über Kriegsopfer und Flüchtlingspopulationen, die mit dem Harvard Trauma Questionnaire durchgeführt wurden, in Bezug auf Ergebnisse, Erfahrungen mit dem Instrument, sowie beobachteten Problemen nach diesem systematischen Modell reanalysiert und verglichen.
Aus den analysierten publizierten Studien bzw. Publikationen geht z.B. oft nicht hervor, ob und in welcher Weise der Fragebogen in der jeweiligen Version, kultursensitiv oder auch ereignisbezogen (unterschiedliche Kriegsereignisse unterschiedlicher Länder) angepasst und validiert wurde.
Die Tatsache, dass sich bestimmte Ereignisse in der einen Kultur in Bezug auf psychopathologische Erkrankungen, im besonderen der PTBS, pathogenetisch äussern, während diese in einer anderen Kultur nicht zu einer Erkrankung führen, bedeutet, bei nicht adaptierten und standardisiert eingesetzten Fragebögen, im Hinblick auf die Validität der gestellten Diagnose, fehlerhafte Resultate.
Die Diplomarbeit diskutiert die Ergebnisse der Analyse in ihren Implikationen in Bezug auf eine Verbesserung und erhöhte Transparenz in der Beforschung der PTBS und formuliert diese schlussfolgernd anhand einer Empfehlungsliste für den Forschungsbereich.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abstract in English
- Einleitung zum Thema und Zielsetzung der Diplomarbeit
- Methodik
- 1. Teil: Allgemeine Grundlagen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
- Definition der Diagnose PTBS
- Ursachen und Verlauf der Erkrankung
- Risikofaktoren
- Geschlechtsspezifisches Risiko
- Prädiktoren
- Komorbidität
- 2. Teil: Die Posttraumatische Belastungsstörung und ihre Komorbidität bei Opfern des Balkan - Bosnienkonflikts, bei Flüchtlingen und Betroffenen anderer politischer Auseinandersetzungen
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund
- Studien zur PTBS und ihrer Komorbidität bei Kriegsopfern / Flüchtlingen des Bosnienkonfliktes
- Das Diagnostikinstrument Harvard Trauma Questionnaire (HTQ)
- Zur Struktur und Entwicklung des Instrumentes
- Der Harvard Trauma Questionnaire in deutscher Fassung
- Zur Anwendung und Relevanz
- In die Auswertung einbezogene Studien, die unter Verwendung des Harvard Trauma Questionnaires durchgeführt wurden
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf der Basis der angeführten Analyse
- Reference List
- Anhang
- Projektplan
- Auswertungsmatrix
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der psychiatrischen Erkrankung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und analysiert die Anwendung des Harvard Trauma Questionnaires (HTQ) in Studien zur Prävalenz von PTBS bei Kriegsopfern und Flüchtlingen. Ziel ist es, die Limitierungen des HTQ in Bezug auf kulturspezifische Unterschiede und die Validität der Diagnostik zu untersuchen.
- Definition und Abgrenzung der PTBS
- Ursachen, Verlauf und Risikofaktoren der PTBS
- Komorbidität der PTBS
- Anwendung und Validität des HTQ in verschiedenen Kulturen
- Empfehlungen für die Verbesserung der Diagnostik und Forschung im Bereich der PTBS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer umfassenden Darstellung der PTBS, ihrer Definition, Ursachen, Verlaufsformen, Risikofaktoren und Komorbidität. Im zweiten Teil wird der Fokus auf die PTBS bei Kriegsopfern und Flüchtlingen gelegt, wobei der historische Hintergrund des Balkan-Bosnienkonflikts beleuchtet wird. Es werden Studien zur PTBS und ihrer Komorbidität bei dieser Population analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf den Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) gelegt wird. Der HTQ wird als ein wichtiges Diagnoseinstrument vorgestellt, seine Struktur und Entwicklung werden erläutert, und es wird auf seine Anwendung und Relevanz eingegangen. Die Diplomarbeit analysiert eine Stichprobe von Studien, die den HTQ zur Diagnostik von PTBS bei Kriegsopfern und Flüchtlingen eingesetzt haben, und untersucht die Ergebnisse, Erfahrungen mit dem Instrument sowie beobachtete Probleme. Die Analyse zeigt, dass die kulturspezifische Adaption des HTQ von großer Bedeutung ist, um valide Ergebnisse zu erzielen. Die Diplomarbeit diskutiert die Ergebnisse der Analyse und formuliert Empfehlungen für die Verbesserung der Diagnostik und Forschung im Bereich der PTBS.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), die Diagnostik, den Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), die kulturspezifische Adaption von Diagnoseinstrumenten, die Validität von Diagnosen, Kriegsopfer, Flüchtlinge, Balkan-Bosnienkonflikt, Komorbidität und die Verbesserung der Forschung im Bereich der PTBS.
- Quote paper
- Anton Volgger (Author), 2011, Die Posttraumatische Belastungsstörung - Probleme der Diagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181313