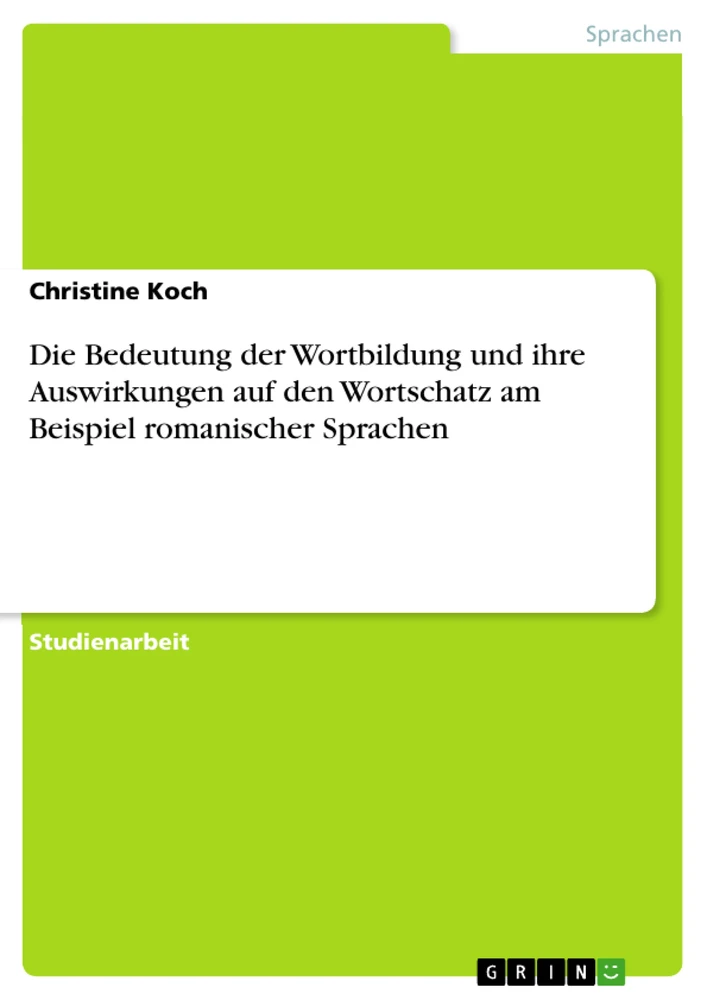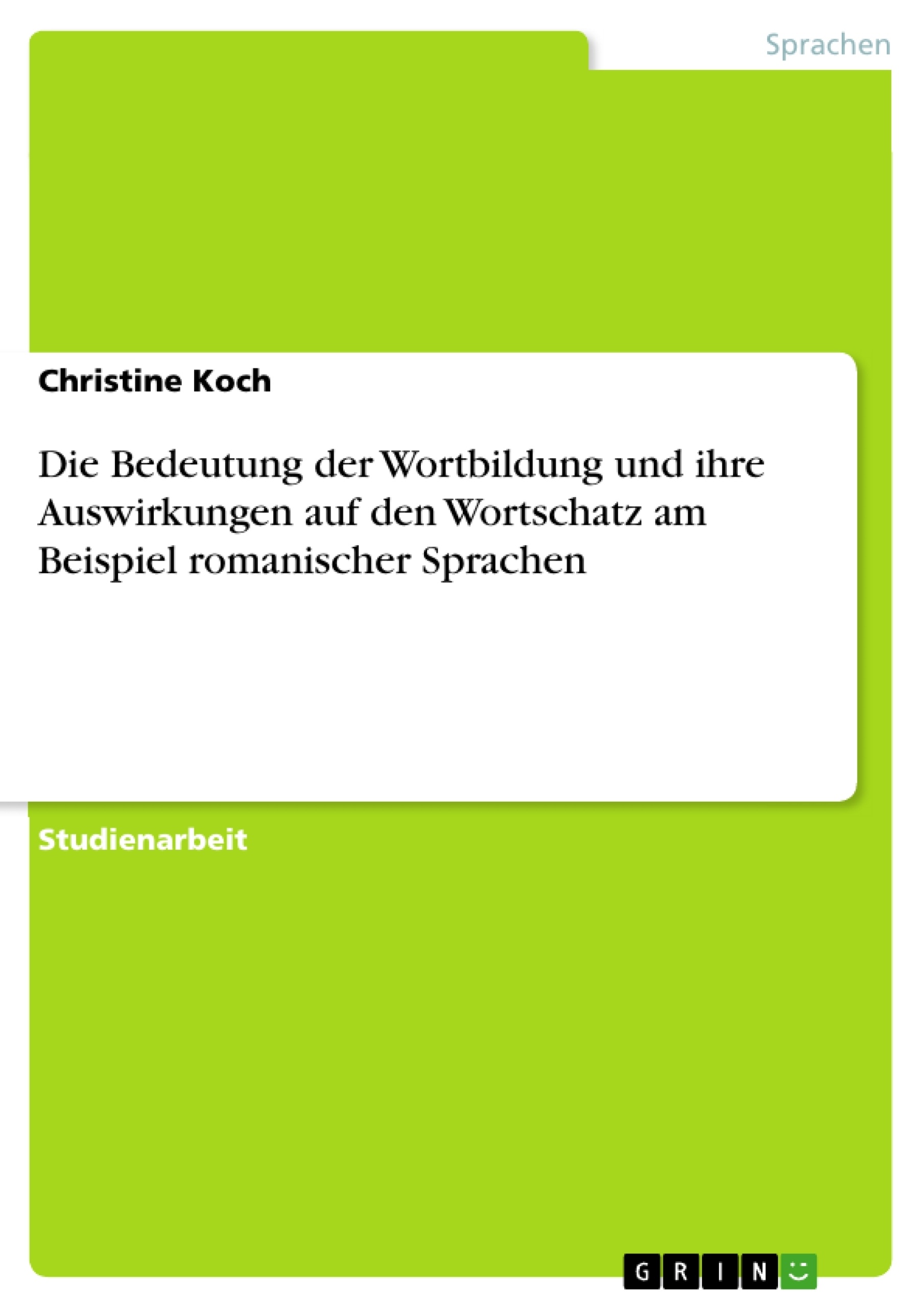0. Einleitung
Fragt man sich, wie das Sprachsystem funktioniert, so gelangt man zu der Erkenntnis, dass es sich um eine Kombination und ein Ineinandergreifen von einzelnen sprachlichen Einheiten handelt. Aus Lauten setzen sich Wörter zusammen, aus Wörtern wiederum Sätze, und schließlich werden ganze Sätze zu einem Text zusammengefügt.
Wird das Wort selbst analysiert und, soweit möglich, in seine Bestandteile zerlegt, spricht man von der Morphologie und Wortbildung. Sie umfasst die Formenlehre, das heißt die Flexionslehre und die Wortartenlehre, daneben auch die Wortbildungslehre. Während die Flexion verschiedene Formen desselben Wortes konstituiert (z.B. frz. je parle, nous parlons), entstehen durch Wortbildung neue Wörter.
Die Wortbildung ist sprachspezifisch unterschiedlich ausgeprägt. So verfügen zum Beispiel die romanischen Sprachen, die in der vorliegenden Arbeit als Veranschaulichung verwendet werden, über ein reiches Reservoir von Derivationsverfahren.
Die Arbeit untergliedert sich in zwei größere Teile. Zuerst werden allgemeine Grundlagen der Wortbildung aufgezeigt. Aufgrund der unzähligen Aspekte, die im Fall der Wortbildung behandelt werden könnten, habe ich mich auf einige wenige Punkte beschränkt. Eingehen werde ich auf die Wortbildung als Verfahren, dabei soll auch die Begriffsdefinition im Vordergrund stehen. Ein anderer zu behandelnder Punkt werden die beiden entscheidenden Ansätze sein, die sich in der Sprachwissenschaft im Hinblick auf die Wortbildung entwickelt haben. Des weiteren möchte ich auf die Begriffe der Motivation, des Wortbildungsmodells und der Lexikalisierung eingehen und versuchen zu klären, welche Rolle sie für die Wortbildungsmorphologie spielen. Darauf folgen dann Ausführungen zur Wortbildungssemantik und der Abgrenzung der Flexion zur Wortbildung.
Der Schwerpunkt des zweiten Teils der Arbeit befasst sich mit der Frage, wie stark die Wortbildung mit einer Erweiterung des Wortschatzes korrespondiert. Sie soll demnach eine Antwort auf die Frage geben, ob jede Wortbildung eine Lexikalisierung mit sich zieht. Wann kommt es bei der Wortbildung zu einer Erweiterung des Wortschatzes und wann nicht? Kann man Wortbildung überhaupt noch als einen Bereich der Morphologie und nicht vielmehr als einen der Lexikologie sehen? Somit besteht der zweite Teil in einer Beschreibung der Wortbildungsverfahren und ihrer Auswirkungen auf den Wortschatz. Mit einigen zusammenfassenden Betrachtungen werde ich die Arbeit sodann schließen.(...)
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Allgemeine Grundlagen zur Wortbildung
- 1.1 Wortbildung als morphologisch-strukturelles Verfahren
- 1.2 Ansätze in der Wortbildung: Generativismus und Strukturalismus
- 1.3 Die Rolle der Motivation
- 1.4 Wortbildungsmodell und Wortbildungsprodukt
- 1.5 Lexikalisierung
- 1.5.1 Wortbildungsbedeutung und Wortschatzbedeutung
- 1.5.2 Wortbildungssemantik
- 1.6 Wortbildung und Flexion
- 2. Wortbildung und Wortschatzerweiterung
- 2.1 Vorbemerkungen
- 2.2 Wortbildung mit Wortschatzerweiterung
- 2.2.1 Derivation
- 2.2.1.1 Semantische Regeln der Derivation
- 2.2.2 Konversion
- 2.2.3 Komposition
- 2.3 Wortschatzerweiterung ohne Wortbildung
- 2.3.1 Wortschöpfung
- 2.3.2 Erbwörter und Entlehnungen
- 2.4 Wortbildung mit relativer Wortschatzerweiterung
- 2.4.1 Wortkürzung
- 2.4.2 Produktive Wörter
- 3. Zusammenfassende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Wortbildung und ihre Auswirkungen auf den Wortschatz romanischer Sprachen. Sie beleuchtet sowohl die allgemeinen Grundlagen der Wortbildung als morphologisch-strukturelles Verfahren, als auch die verschiedenen Ansätze in der Wortbildungsforschung (Generativismus und Strukturalismus). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beziehung zwischen Wortbildung und Wortschatzerweiterung.
- Wortbildung als morphologisch-strukturelles Verfahren
- Generative und strukturalistische Ansätze in der Wortbildung
- Die Rolle der Motivation in der Wortbildung
- Zusammenhang zwischen Wortbildung und Wortschatzerweiterung
- Analyse verschiedener Wortbildungsverfahren (Derivation, Konversion, Komposition)
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Wortbildung ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie betont die sprachspezifische Ausprägung der Wortbildung, insbesondere im Romanischen, und skizziert die zentrale Fragestellung: den Zusammenhang zwischen Wortbildung und Wortschatzerweiterung. Die Arbeit von Marchand dient als grundlegende Definition für Wortbildung, welche die "Zwischenstellung" zwischen Grammatik und Lexik hervorhebt.
1. Allgemeine Grundlagen zur Wortbildung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die folgende Analyse. Es differenziert zwischen semantischen, syntaktischen und morphologisch-strukturellen Verfahren der Wortbildung, wobei letzteres im Mittelpunkt der Arbeit steht. Die Diskussion der generativen und strukturalistischen Ansätze in der Wortbildungsforschung beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf Wortbildungsprozesse – statisch-deskriptiv versus dynamisch-prozessorientiert. Schließlich wird die Rolle der Motivation in der Wortbildung erläutert, mit dem Fokus darauf, dass motivierte Wörter in ihrer formalen und inhaltlichen Beschaffenheit durchschaubar sind.
2. Wortbildung und Wortschatzerweiterung: Der zweite Teil konzentriert sich auf den Kern der Untersuchung: das Verhältnis zwischen Wortbildung und Wortschatzerweiterung. Hier werden verschiedene Wortbildungsverfahren und ihre Auswirkungen auf den Wortschatz detailliert beschrieben. Die Kapitel behandeln Derivation, Konversion und Komposition als Verfahren zur Wortschatzerweiterung, aber auch Wortschöpfung, Erbwörter und Entlehnungen als alternative Wege zur Erweiterung des Wortschatzes. Das Kapitel analysiert auch die Fälle, in denen Wortbildung keine Wortschatzerweiterung mit sich bringt (z.B. Wortkürzungen).
Schlüsselwörter
Wortbildung, Morphologie, Romanische Sprachen, Wortschatzerweiterung, Lexikalisierung, Derivation, Konversion, Komposition, Generativismus, Strukturalismus, Motivation, Semantik.
Häufig gestellte Fragen zu: Wortbildung und Wortschatzerweiterung in romanischen Sprachen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Wortbildung und ihre Auswirkungen auf den Wortschatz romanischer Sprachen. Sie beleuchtet die allgemeinen Grundlagen der Wortbildung als morphologisch-strukturelles Verfahren und verschiedene Ansätze in der Wortbildungsforschung (Generativismus und Strukturalismus). Ein Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang zwischen Wortbildung und Wortschatzerweiterung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Wortbildung als morphologisch-strukturelles Verfahren, generative und strukturalistische Ansätze in der Wortbildung, die Rolle der Motivation in der Wortbildung, den Zusammenhang zwischen Wortbildung und Wortschatzerweiterung, sowie eine Analyse verschiedener Wortbildungsverfahren (Derivation, Konversion, Komposition).
Welche Wortbildungsverfahren werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Wortbildungsverfahren Derivation, Konversion und Komposition. Zusätzlich werden Wortschöpfung, Erbwörter und Entlehnungen als alternative Wege der Wortschatzerweiterung behandelt. Auch Fälle, in denen Wortbildung keine Wortschatzerweiterung bewirkt (z.B. Wortkürzungen), werden untersucht.
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt generative und strukturalistische Ansätze in der Wortbildungsforschung. Diese unterschiedlichen Perspektiven – statisch-deskriptiv versus dynamisch-prozessorientiert – werden beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis der Wortbildungsprozesse zu ermöglichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den allgemeinen Grundlagen der Wortbildung, ein Kapitel zu Wortbildung und Wortschatzerweiterung und eine zusammenfassende Betrachtung. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Das erste Kapitel legt die theoretischen Grundlagen, während das zweite Kapitel den Kern der Untersuchung darstellt – das Verhältnis zwischen Wortbildung und Wortschatzerweiterung.
Welche Rolle spielt die Motivation in der Wortbildung?
Die Rolle der Motivation in der Wortbildung wird erläutert. Der Fokus liegt dabei auf der Durchschaubarkeit motivierter Wörter in ihrer formalen und inhaltlichen Beschaffenheit.
Welche Bedeutung hat die Lexikalisierung?
Die Arbeit behandelt die Lexikalisierung im Kontext der Wortbildungsbedeutung und Wortschatzbedeutung sowie der Wortbildungssemantik. Es wird der Unterschied zwischen der Bedeutung eines neugebildeten Wortes (Wortbildungsbedeutung) und seiner Bedeutung im etablierten Wortschatz (Wortschatzbedeutung) untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wortbildung, Morphologie, Romanische Sprachen, Wortschatzerweiterung, Lexikalisierung, Derivation, Konversion, Komposition, Generativismus, Strukturalismus, Motivation, Semantik.
Welche Definition von Wortbildung wird verwendet?
Die Arbeit verwendet Marchands Definition von Wortbildung, welche die "Zwischenstellung" zwischen Grammatik und Lexik hervorhebt.
- Quote paper
- M.A. Christine Koch (Author), 2005, Die Bedeutung der Wortbildung und ihre Auswirkungen auf den Wortschatz am Beispiel romanischer Sprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181327