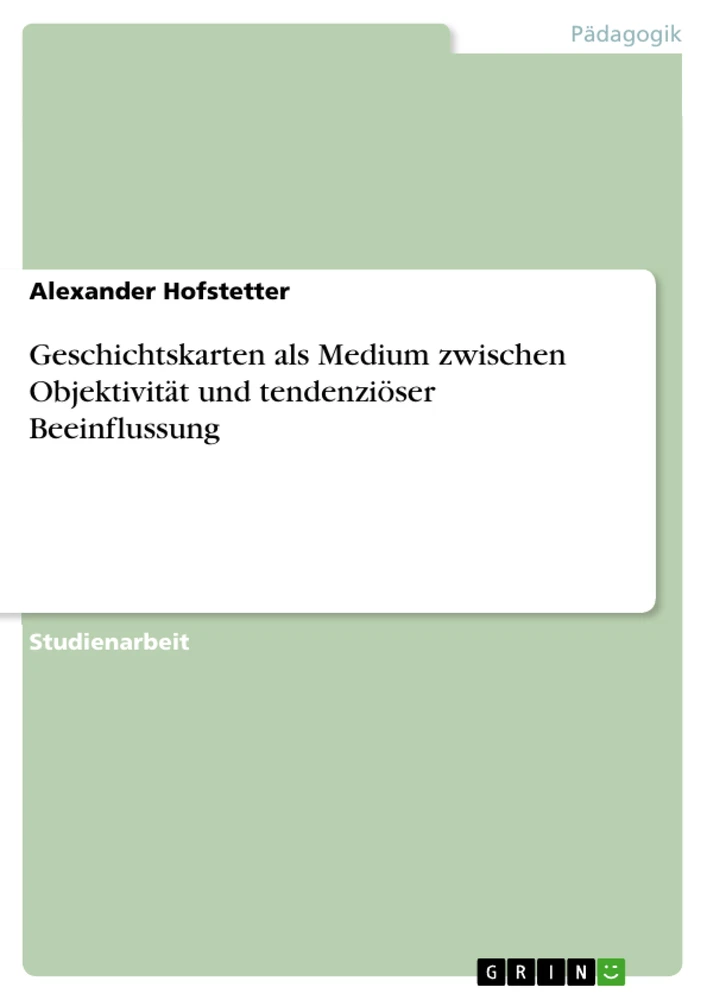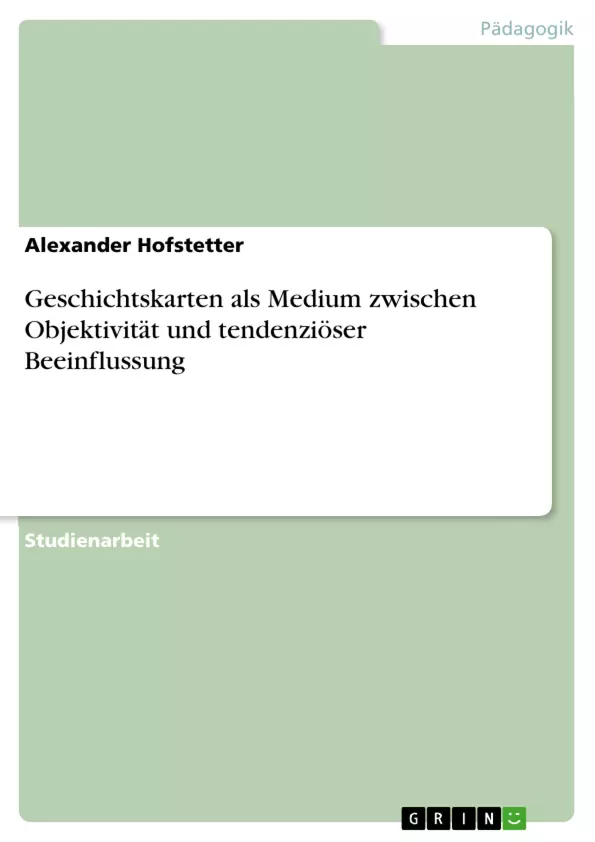Karten haben eine wichtige Orientierungsfunktion im Alltag. Sie können uns täglich in Form eines Stadtplanes, eines Autoatlasses oder als Skizze in einer Zeitung begegnen. Doch obwohl eine häufige Auseinandersetzung mit Karten und kartenähnlichen Abbildungen unumgänglich ist, scheint es trotzdem, dass die Kulturtechnik des Kartenlesens eher autodidaktisch und nebenher erlernt wird. Im Geschichtsunterricht liegt das Augenmerk wohl eher auf der Verwendung anderer Quellen, wie historischen Texten und Bildern, als auf der Nutzung historischer Karten und dem Gebrauchen von Geschichtskarten. Eine grundlegende Einführung in die eigentliche Kartenarbeit findet im Unterricht auch kaum Platz. Doch genau dies wäre von entscheidender Wichtigkeit, wenn es darum geht, mit der dargestellten „Wirklichkeit“ richtig umzugehen. Geschichtskarten veranschaulichen Staatengebilde, doch darüber hinaus verdeutlichen sie historische Zustände, Entwicklungen und Zusammenhänge. Um diese Kriterien jedoch korrekt auffassen zu können, müssen Karten gelesen und nicht nur betrachtet werden. Genauso ist es essentiell, Karten die die gleichen Aspekte thematisieren, untereinander zu vergleichen um somit zu einer objektiven Geschichtsbetrachtung und auch
– auffassung zu gelangen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Beeinflussung durch Geschichtskarten. Ob im Sinne gewollter Manipulation oder durch ungewollte Einflussnahme auf den Betrachter, Geschichtskarten können die objektive Geschichtsbetrachtung beeinträchtigen.
Daher sollen einflussnehmende Aspekte durch Kartenbetrachtung in dieser Arbeit näher erläutert und thematisiert werden sowie anhand von exemplarischen Fallbeispielen verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I) Problematik des Kartenverständnisses...
- II) Potentielle Beeinflussung durch Geschichtskarten...
- 1.) Grundlegende Aspekte...
- 2.) Unterschiedliche Kartentypen...
- 3.) Historischer Wandel im Kartographischen Zeichensystem..
- 4.) Grundlagen zum Kartenverständnis.
- 5.) Ausgewählte Fallbeispiele..
- a) Die Varusschlacht...
- b) Das Frankenreich Karls des Großen..
- c) Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Frieden.....
- d) Mitteleuropa nach dem Westfälischen Frieden (Schulbuchkarte)
- e) Zeitalter des Imperialismus..
- f) Deutschland im 20. Jahrhundert..
- III) Abschließende Zusammenfassung...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik der Beeinflussung durch Geschichtskarten. Es wird untersucht, inwiefern Karten, sei es durch gewollte Manipulation oder ungewollte Einflussnahme, die objektive Geschichtsbetrachtung beeinträchtigen können. Dabei werden einflussnehmende Aspekte durch Kartenbetrachtung näher erläutert und thematisiert sowie anhand von exemplarischen Fallbeispielen verdeutlicht.
- Die Rolle von Karten im Geschichtsunterricht
- Die Interpretation von Karten als Quelle
- Die Grenzen und Möglichkeiten der Kartographie
- Die Bedeutung der Kartensprache für das Verständnis historischer Ereignisse
- Die potentielle Beeinflussung durch Geschichtskarten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problematik des Kartenverständnisses. Es wird deutlich, dass Karten trotz ihrer omnipräsenten Präsenz im Alltag häufig unreflektiert betrachtet werden.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten von Karten und den Möglichkeiten der Beeinflussung durch Geschichtskarten. Hier werden grundlegende Aspekte der Kartographie, die Unterscheidung verschiedener Kartentypen und der historische Wandel im kartographischen Zeichensystem beleuchtet. Die Kapitel endet mit einer Diskussion der Grenzen und Möglichkeiten der Karteninterpretation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Themen: Geschichtskarten, historische Karten, Karteninterpretation, Kartographie, Beeinflussung, Manipulation, Objektivität, Geschichtsverständnis, Kartensprache, Fallbeispiele.
- Citar trabajo
- Alexander Hofstetter (Autor), 2006, Geschichtskarten als Medium zwischen Objektivität und tendenziöser Beeinflussung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181363