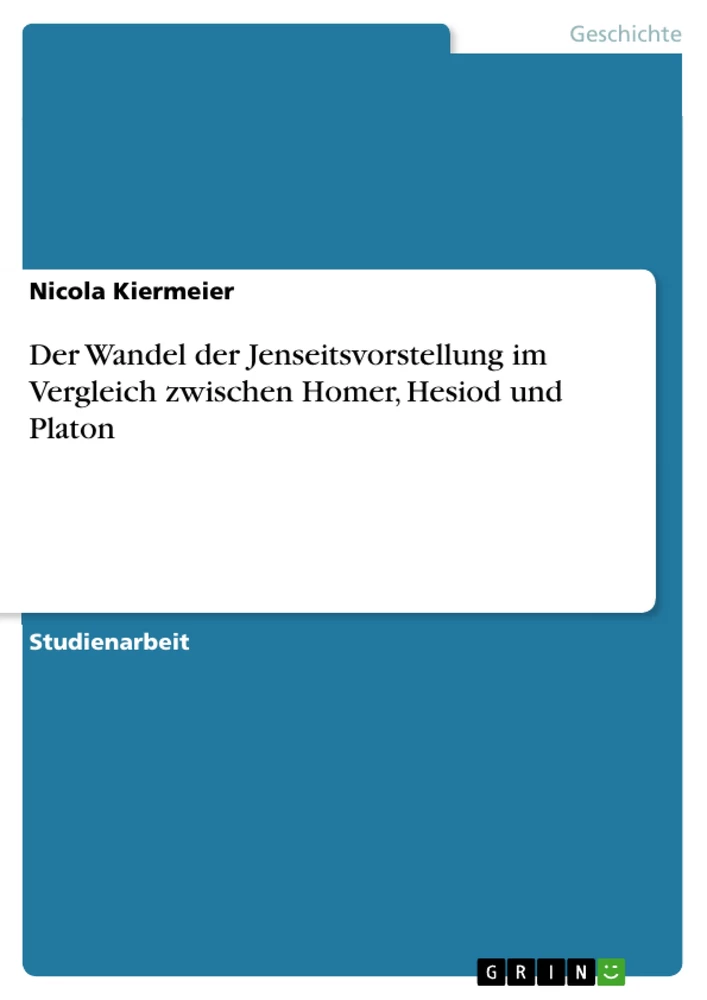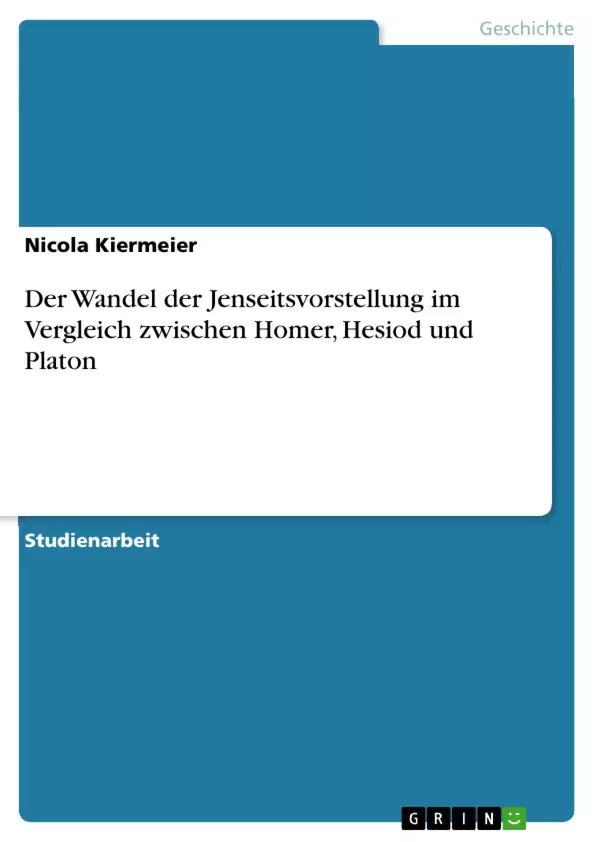„Der Tod öffnet der dahinscheidenden Seele nicht die Tore zur Hölle und Verdammnis, sondern er schließt sie hinter ihr.“ (Waldemar Bonsels)
Die Vorstellung des Jenseits beschäftigt die Menschen schon seit sie existieren. Grund hierfür ist wahrscheinlich die Tatsache, dass der Tod unausweichlich für den Menschen als sterbliches Wesen ist. Doch so ungewiss die Situation nach dem Tod ist, so vielfältig sind auch die Vorstellungen vom Leben nach dem Tod, wenn es überhaupt dergleichen gibt. Da es keine absolute Wahrheit gibt, konnten sich viele verschieden Überzeugungen entwickeln, verändern und neu konstruieren. Daher möchte ich in dieser Arbeit einen kleinen Auszug von Jenseitsvorstellungen anbieten, um den Wandel vom Glauben und der Vorstellung an das Jenseits innerhalb weniger Generationen deutlich zu machen. Ich werde zunächst die Schilderungen Homers über das Totenreich und sein Elysium in der Odyssee und der Ilias darstellen und dann mit Hesiods Tartaros und seinen Inseln der Seligen in der Theogonie und in Werke und Tage fortfahren. Da beide noch in der gleichen Tradition stehen, stelle ich ihnen abrundend Platons Seelenlehre in der Gorgias und im Phaidon gegenüber, welche sich deutlich von Homer und Hesiod abgrenzt. Mit seiner revolutionären Idee von der Seelenwanderung bereitet er den Boden für unsere heutige christliche Auffassung von der Trennung von Körper und Seele und von einem Leben nach dem Tod.
Als Grundlage meiner Arbeit benutze ich Werke von Homer, Hesiod und Platon, sowie Literatur von L. Radermacher, Rainer Foß und einen Zeitschriftenartikel von Christoph Horn.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Totenreich- und Elysiumsdarstellungen
- Totenreich- und Elysiumsdarstellung bei Homer
- Das Totenreich Homers
- Homerisches Elysium
- Totenreich- und Elysiumsdarstellung bei Hesiod
- Hesiods Tartaros
- Die Insel der Seligen
- Platons Seelenlehre
- Platons Jenseitssystem
- Das Jenseitsgericht
- Das platonische Himmelreich
- Die Seelenwanderung
- Der platonische Tartaros
- Totenreich- und Elysiumsdarstellung bei Homer
- Fazit
- Grafikverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Jenseitsvorstellung im antiken Griechenland, indem sie die Darstellungen von Homer, Hesiod und Platon vergleicht. Ziel ist es, den Wandel der Jenseitsvorstellung innerhalb weniger Generationen aufzuzeigen und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Konzepten zu beleuchten.
- Das Totenreich in der griechischen Mythologie
- Die Rolle von Homer und Hesiod in der Entwicklung der Jenseitsvorstellung
- Platons revolutionäre Seelenlehre und ihre Auswirkungen auf die Jenseitsvorstellung
- Der Einfluss der Jenseitsvorstellung auf die antike Gesellschaft
- Die Bedeutung der Jenseitsvorstellung für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Jenseitsvorstellung ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie stellt die drei zentralen Figuren der Arbeit, Homer, Hesiod und Platon, vor und skizziert die Grundzüge ihrer Jenseitsvorstellungen.
Das Kapitel "Totenreich- und Elysiumsdarstellungen" untersucht die Jenseitsvorstellungen von Homer und Hesiod. Es werden die Beschreibungen des Totenreichs und des Elysiums in den Werken Homers, insbesondere in der Odyssee und der Ilias, sowie die Darstellung des Tartaros und der Inseln der Seligen in den Werken Hesiods, wie der Theogonie und Werke und Tage, analysiert.
Das Kapitel "Platons Seelenlehre" widmet sich Platons Jenseitsvorstellung, die sich deutlich von den Vorstellungen Homers und Hesiods abhebt. Es werden Platons Jenseitssystem, das Jenseitsgericht, das platonische Himmelreich, die Seelenwanderung und der platonische Tartaros im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Jenseitsvorstellung, das Totenreich, das Elysium, der Tartaros, die Seelenwanderung, Homer, Hesiod, Platon, die griechische Mythologie, die antike Gesellschaft und die Entwicklung der Jenseitsvorstellung.
- Quote paper
- Nicola Kiermeier (Author), 2009, Der Wandel der Jenseitsvorstellung im Vergleich zwischen Homer, Hesiod und Platon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181428