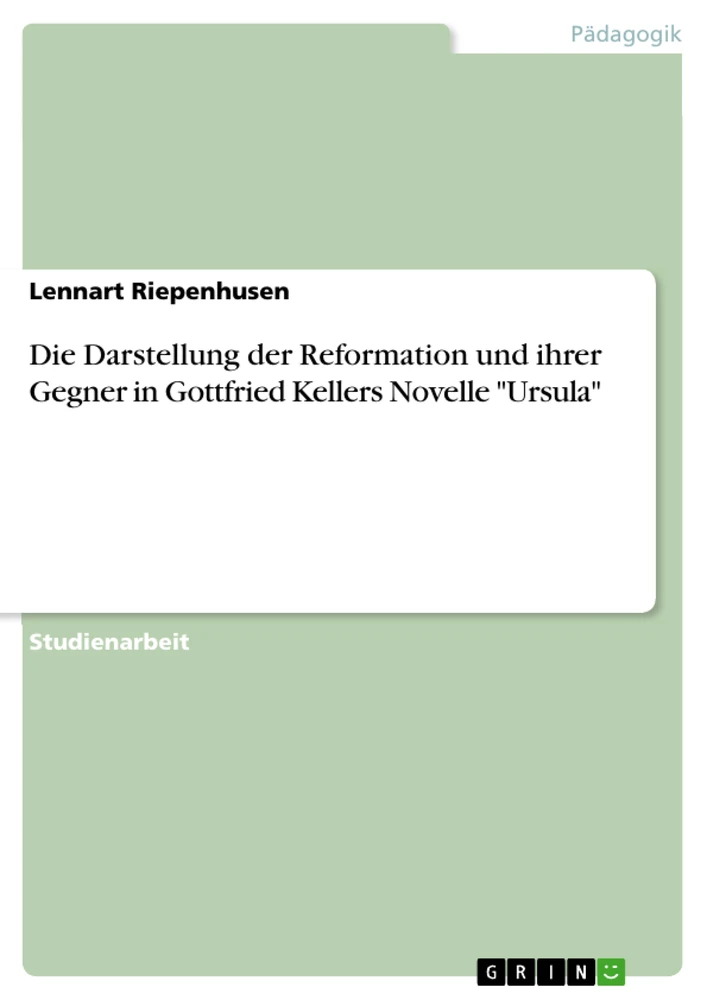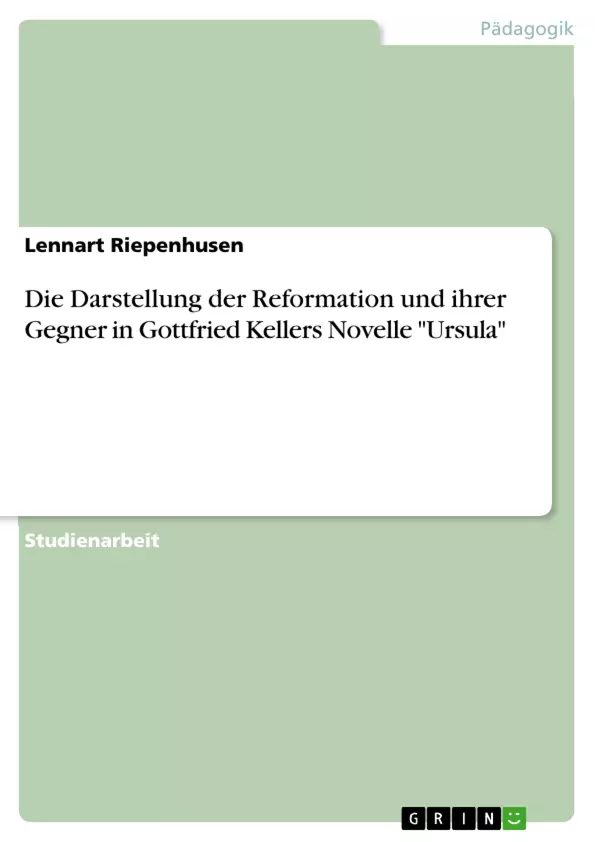Ziel dieser Hausarbeit ist es, die verschiedenen Darstellungen der Reformation und ihrer Gegner innerhalb von „Ursula“ herauszuarbeiten. Dazu werde ich zunächst kurz auf die Geschichte der schweizerischen Reformation unter Ulrich Zwingli und auf dessen Biografie eingehen. Anschließend werde ich die Darstellung der wichtigsten Vertreter der Reformation in „Ursula“, Ulrich Zwingli und Hansli Gyr, herausarbeiten. Dann werde ich auf die Glaubensbewegung der Täufer und daraufhin deren Darstellung durch Gottfried Keller herausarbeiten, um abschließend die Gesamtdarstellung der Reformatoren und ihrer Gegner miteinander zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Hintergründe
- Die Schweizer Reformation zwischen 1519 und 1531
- Ulrich Zwingli
- Die Darstellung der Reformation in Gottfried Kellers Novelle „Ursula“
- Die Darstellung Ulrich Zwinglis
- Hansli Gyr
- Die Gegner der Reformation in Gottfried Kellers Novelle „Ursula“
- Die Täuferbewegung
- Das Bild der Täufer in Kellers Novelle „Ursula“
- Ursula
- Vergleich der Darstellungen der Reformation und ihrer Gegner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Gottfried Kellers Novelle „Ursula“ und untersucht die Darstellung der Reformation und ihrer Gegner innerhalb des Werkes. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven auf die Reformation in der Schweiz im 16. Jahrhundert aufzuzeigen und die literarische Gestaltung dieser historischen Ereignisse durch Keller zu analysieren.
- Die Schweizer Reformation unter Ulrich Zwingli
- Die Darstellung der Reformation in „Ursula“
- Die Täuferbewegung und deren Darstellung in der Novelle
- Der Vergleich der verschiedenen Perspektiven auf die Reformation und ihre Gegner
- Die literarische Gestaltung der historischen Ereignisse durch Keller
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Novelle „Ursula“ und ihren historischen Kontext vor. Sie beschreibt die Handlung und das Ziel der Hausarbeit, welches darin besteht, die verschiedenen Darstellungen der Reformation und ihrer Gegner in der Novelle zu analysieren.
Geschichtliche Hintergründe
Das Kapitel beleuchtet die Schweizer Reformation im Zeitraum von 1519 bis 1531, fokussiert auf Ulrich Zwingli und seine Rolle. Es beschreibt die Anfänge der Reformation in Zürich und die Entstehung des Konflikts zwischen Zwingli und den Gegnern der Reformation, insbesondere den Fünf Orten.
Die Darstellung der Reformation in Gottfried Kellers Novelle „Ursula“
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung der Reformation in „Ursula“. Es untersucht die Figur Ulrich Zwingli und seinen Einfluss auf Hansli Gyr, den Protagonisten der Novelle.
Die Gegner der Reformation in Gottfried Kellers Novelle „Ursula“
Das Kapitel betrachtet die Darstellung der Gegner der Reformation in „Ursula“, insbesondere die Täuferbewegung. Es analysiert das Bild der Täufer in Kellers Novelle und ihre Auswirkungen auf die Handlung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schweizer Reformation, Ulrich Zwingli, Täuferbewegung, Gottfried Keller, Novelle „Ursula“, historische Ereignisse, literarische Gestaltung, Perspektiven, Vergleich, Konflikte.
- Citar trabajo
- Lennart Riepenhusen (Autor), 2007, Die Darstellung der Reformation und ihrer Gegner in Gottfried Kellers Novelle "Ursula", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181429