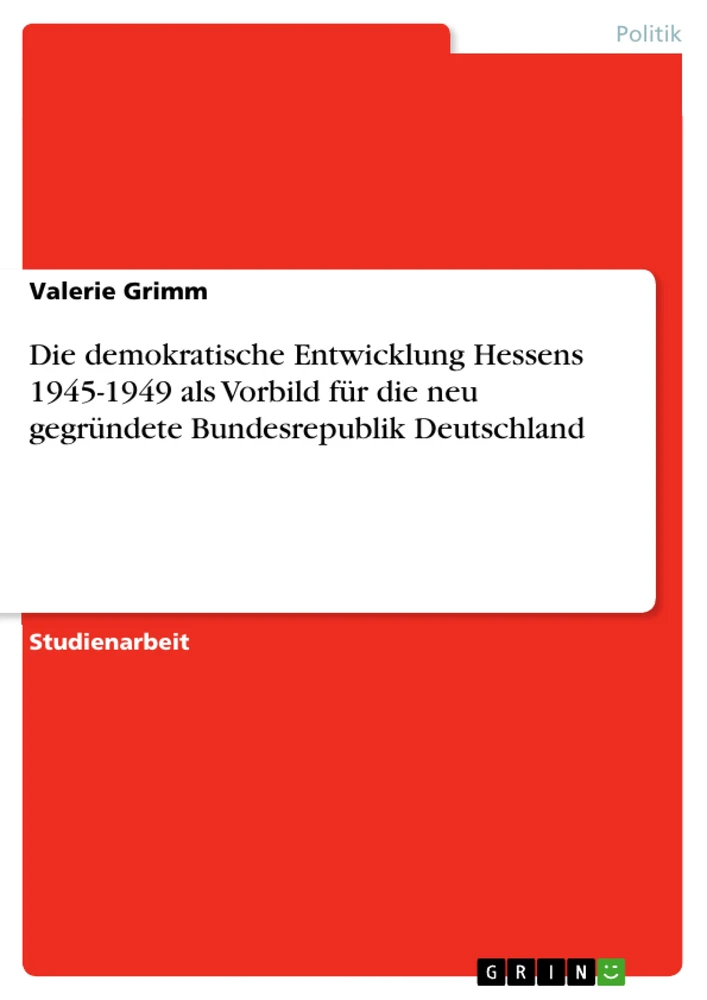Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob bzw. inwieweit in Hessen im Zeitraum 1945-1949 eine demokratische Entwicklung stattgefunden hat und in wie fern das Land dabei als Vorbild für die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland (BRD) betrachtet werden kann.
Zunächst werfe ich in Kapitel 2 einen kurzen Blick auf die Ausgangslage in Deutschland und speziell in Hessen, unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 08. Mai 1945.
Anschließend soll die Entwicklung der Demokratie mit besonderem Augenmerk auf Hessen analysiert werden, wobei näher auf die damalige Regierung sowie das neu entstandene Parteiensystem eingegangen wird. Daraufhin erfolgt ein genauerer Blick auf die Geschichte der Sozialdemokratie bzw. der SPD in Hessen.
Nachdem im Verlauf der Arbeit auf die Hessische Verfassung von 1946, die Entnazifizierung, sowie den Prozess der Wiedergutmachung in Hessen eingegangen wird, folgt ein Überblick hinsichtlich der umgesetzten Reformen im Bezug auf Wirtschaft und Sozialwesen und anschließend bezüglich Bildungs- und Medienpolitik in Hessen.
In Kapitel 6 versuche ich unter Zuhilfenahme verschiedener Autoren-Meinungen ein Fazit zu ziehen hinsichtlich der eingangs aufgeworfenen Frage nach der etwaigen Vorbildfunktion des neu entstandenen Landes Hessen für die ebenfalls neu gegliederte Bundesrepublik Deutschland.
2. Ausgangslage nach 1945
Im Jahr 1945 bzw. nach dem Ende des verlorenen 2. Weltkrieges stand Deutschland vor einem „Trümmerhaufen“ und schier unlösbaren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen und Problemen:
Nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 hatten die Alliierten das komplette Staatsgebiet besetzt und die Regierungen der Siegermächte übernahmen daraufhin die oberste Regierungsgewalt in Deutschland.
Grundlage hierfür war das am 5. Juni unterzeichnete "Vier-Mächte-Abkommen" durch die vier alliierten Befehlshaber in Berlin. Das Deutsche Reich wurde in seinen Grenzen von 1937 in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Das heutige Hessen fiel dabei, genau wie Württemberg-Baden und Bayern, der amerikanischen Zone zu.
Das Regieren wurde von der Viermächte-Verwaltung auf drei Ebenen vollzogen:
Oberste Entscheidungsebene war die ständige Außenministerkonferenz der vier Großmächte. Darunter befand sich der Alliierte Kontrollrat, welcher (gewissermaßen in Form einer Treuhandschaft) die von den Alliierten übernommene Staatsgewalt ausüben sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage nach 1945.
- Demokratie in Hessen
- Regierung und Parteiensystem
- Parteien.
- SPD..
- Verfassung......
- Entnazifizierung
- Regierung und Parteiensystem
- Wiedergutmachung
- Reformen.
- Wirtschaft und Sozialwesen
- Bildungs- und Medienpolitik
- Fazit: Vorbildcharakter?.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die demokratische Entwicklung Hessens zwischen 1945 und 1949 und analysiert, ob und inwiefern das Land als Vorbild für die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland dienen konnte. Die Analyse konzentriert sich auf die Herausforderungen der unmittelbaren Nachkriegszeit, den Aufbau der Demokratie, die politische und soziale Entwicklung und die Frage nach dem Vorbildcharakter Hessens für die BRD.
- Die Ausgangslage in Hessen nach dem Zweiten Weltkrieg
- Der Aufbau der Demokratie und das neue Parteiensystem
- Die Rolle der Sozialdemokratie (SPD) in Hessen
- Die Hessische Verfassung von 1946 und die Entnazifizierung
- Die Umsetzung von Reformen in Wirtschaft, Sozialwesen, Bildung und Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die schwierige Ausgangslage in Hessen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Es werden die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen dargestellt, die das Land nach der Kapitulation des Deutschen Reiches zu bewältigen hatte.
Kapitel 3 fokussiert auf die Entwicklung der Demokratie in Hessen. Es wird die Bildung der Regierung, die Entstehung des neuen Parteiensystems und die Rolle der SPD in diesem Prozess beleuchtet. Außerdem wird die Rolle der Hessischen Verfassung von 1946 und der Entnazifizierung in der Demokratisierung des Landes analysiert.
Kapitel 4 behandelt die Wiedergutmachung gegenüber den Opfern des NS-Regimes in Hessen. Die Schwerpunkte liegen auf den Maßnahmen, die zur Entschädigung und Wiederherstellung der Würde der verfolgten Menschen getroffen wurden.
Kapitel 5 befasst sich mit den wichtigsten Reformen, die im Bereich der Wirtschaft, des Sozialwesens, der Bildung und der Medien in Hessen durchgeführt wurden. Es wird analysiert, wie die Politik die wirtschaftlichen Probleme und die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung angegangen hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die demokratische Entwicklung Hessens im Zeitraum 1945-1949 und thematisiert die Herausforderungen der Nachkriegszeit, die Bildung eines neuen Regierungssystems, die Rolle der Sozialdemokratie, die Bedeutung der Verfassung, die Entnazifizierung und die Umsetzung von Reformen. Darüber hinaus wird der potenzielle Vorbildcharakter Hessens für die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland beleuchtet.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Valerie Grimm (Autor:in), 2008, Die demokratische Entwicklung Hessens 1945-1949 als Vorbild für die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181441