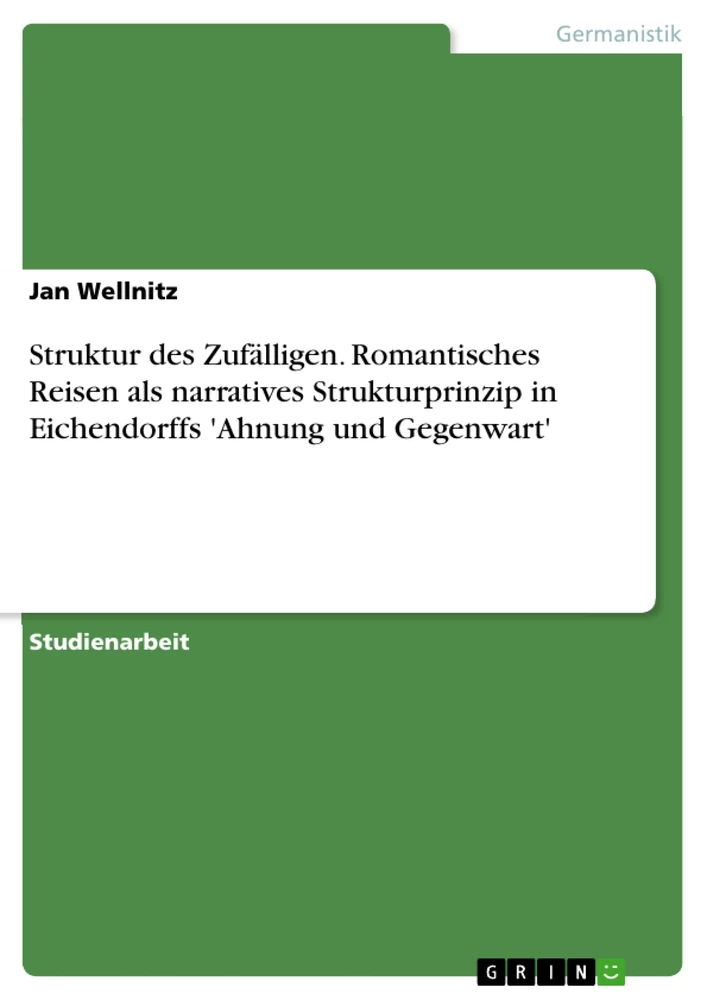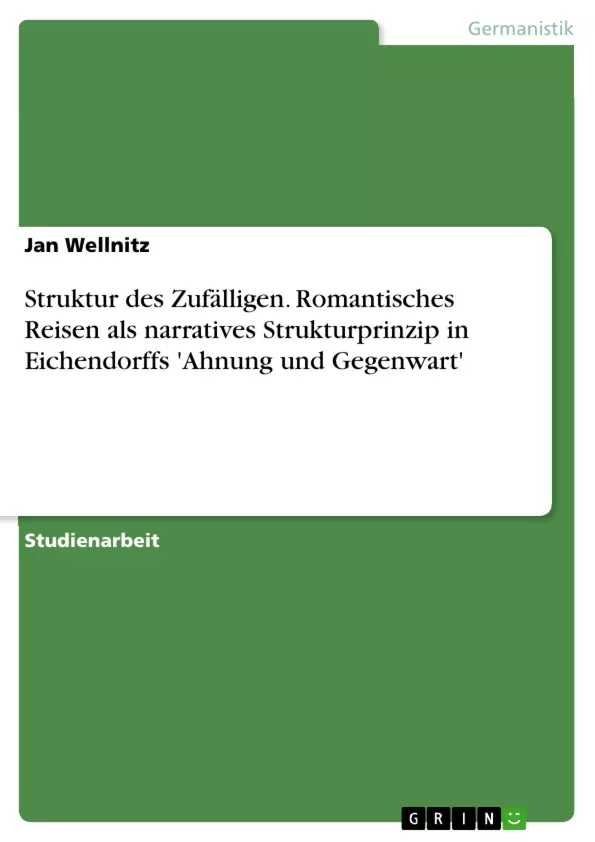Wie in vielen Texten der romantischen Epoche, spielt auch in Eichendorffs 1815 veröffentlichtem Roman "Ahnung und Gegenwart" die Reise eine übergeordnete Rolle. Obgleich sich das Reisen hier vordergründig jedweder Zielgerichtetheit entzieht, konstituiert es ein strukturierendes Prinzip für die gesamte Narration.
Es unterteilt den Roman in drei strukturelle Großräume. Die Großräume der Provinz, der Residenz und der Rückbesinnung auf die Provinz. Analog zur tradierten Folie, erhalten diese Strukturgroßräume den Rang „des Auszugs, der „Er-Fahrung“ der Welt und der Heimkehr“.
In der vorliegenden Arbeit soll erörtert werden, wie der Roman diese Triasstruktur organisiert und wie durch weitere Reisen innerhalb der drei Großräume zahlreiche Subkategorien entworfen werden. Teils in enger Textanalyse, teils in größeren Zusammenhängen soll des Weiteren erarbeitet werden, wie sich innerhalb dieser durch Reisen kreierten Mirko- beziehungsweise Makrostruktur eine Linie von Brechungen vollzieht, die schließlich mit dem Eintritt ins Kloster ihr Ende findet.
Immer in einem Kontext des Reisens betrachtet, sollen dafür exemplarisch das frühe Dichterbild sowie die frühe Liebe des ersten Großraums untersucht und beschrieben werden. In einem weiteren Schritt sollen anschließend die Modifikationen, die diese Motive während des zweiten Großraums erfahren, herausgestellt werden. Für den dritten Großraum soll zum einen Friedrichs Suche nach der eigenen Vergangenheit, zum anderen das finale Moment des Klostereinritts untersucht und bewertet werden.
In einer Schlussbetrachtung sollen die verschiedenen Reiseeinheiten und Stationen in einen abschließenden Gesamtkontext gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strukturierendes Reisen
- Die Provinz
- Friedrichs frühes Dichterbild
- Die frühe Liebe zu Rosa
- Die Residenz
- modifiziertes Dichterbild
- Abwegige Liebe
- Rückkehr in die Provinz
- Zielgerichtetes Reisen: Die Suche nach der eignen Vergangenheit
- Textnahe Analyse zum, Wahrnehmen der innersten Bestimmung’
- Die Provinz
- Schlussbetrachtung
- Anhang
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle des Reisens als narratives Strukturprinzip in Eichendorffs Roman „Ahnung und Gegenwart“. Sie analysiert, wie die Reise den Roman in drei strukturelle Großräume unterteilt: die Provinz, die Residenz und die Rückkehr in die Provinz. Darüber hinaus werden die Subkategorien innerhalb dieser Großräume untersucht, die durch weitere Reisen entstehen. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Dichterbildes und der Liebe des Protagonisten Friedrich im Kontext des Reisens und zeigt auf, wie sich diese Motive im Laufe der Geschichte verändern.
- Die Rolle des Reisens als narratives Strukturprinzip
- Die drei strukturellen Großräume des Romans: Provinz, Residenz, Rückkehr in die Provinz
- Die Entwicklung des Dichterbildes
- Die Entwicklung der Liebe des Protagonisten
- Die Bedeutung des Klostereintritts
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Großraum des Romans, die Provinz, wird durch Friedrichs Schifffahrt auf der Donau eingeführt. Der Aufenthalt auf Leontins Schloss, das gemeinsame Reisen der Gesellschaft und die Zeit auf dem Gut des Herrn von A. prägen dieses provinzielle Raumerleben. Friedrichs frühes Dichterbild entwickelt sich in dieser Phase, geprägt von Idealismus und der Überzeugung vom Veränderungspotenzial des Dichters. Er sieht den Dichter als ein über der Gesellschaft stehendes Individuum, das die Welt in ihrer Ganzheit und Schönheit erfassen kann. Die Liebe zu Rosa, die in diesem Großraum ihren Anfang nimmt, ist geprägt von jugendlicher Leidenschaft und romantischen Idealen.
Der zweite Großraum, die Residenz, führt Friedrich in eine neue Umgebung und konfrontiert ihn mit neuen Erfahrungen. Das Dichterbild des Protagonisten erfährt in dieser Phase eine Modifikation, die durch die Begegnung mit dem erfahrenen Dichter Faber ausgelöst wird. Friedrichs Liebe zu Rosa wird durch die Begegnung mit anderen Frauen und die Entdeckung der komplexen Welt der Liebe in Frage gestellt.
Der dritte Großraum, die Rückkehr in die Provinz, zeichnet sich durch Friedrichs Suche nach der eigenen Vergangenheit aus. Er reist zurück in seine Heimat, um seine Wurzeln und seine Identität neu zu entdecken. Die Reise führt ihn schließlich zum Kloster, wo er sein Leben neu ordnet und sich dem spirituellen Weg zuwendet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das romantische Reisen, die Struktur des Zufälligen, die Entwicklung des Dichterbildes, die Liebe in der Romantik, die Provinz, die Residenz, die Rückkehr in die Provinz, das Kloster und die Suche nach der eigenen Identität. Der Text analysiert Eichendorffs Roman „Ahnung und Gegenwart“ und beleuchtet die Rolle des Reisens als narratives Strukturprinzip, das den Roman in verschiedene Großräume und Subkategorien unterteilt. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Protagonisten Friedrichs im Kontext des Reisens und zeigt auf, wie sich sein Dichterbild und seine Liebe im Laufe der Geschichte verändern.
- Quote paper
- Jan Wellnitz (Author), 2010, Struktur des Zufälligen. Romantisches Reisen als narratives Strukturprinzip in Eichendorffs 'Ahnung und Gegenwart', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181446