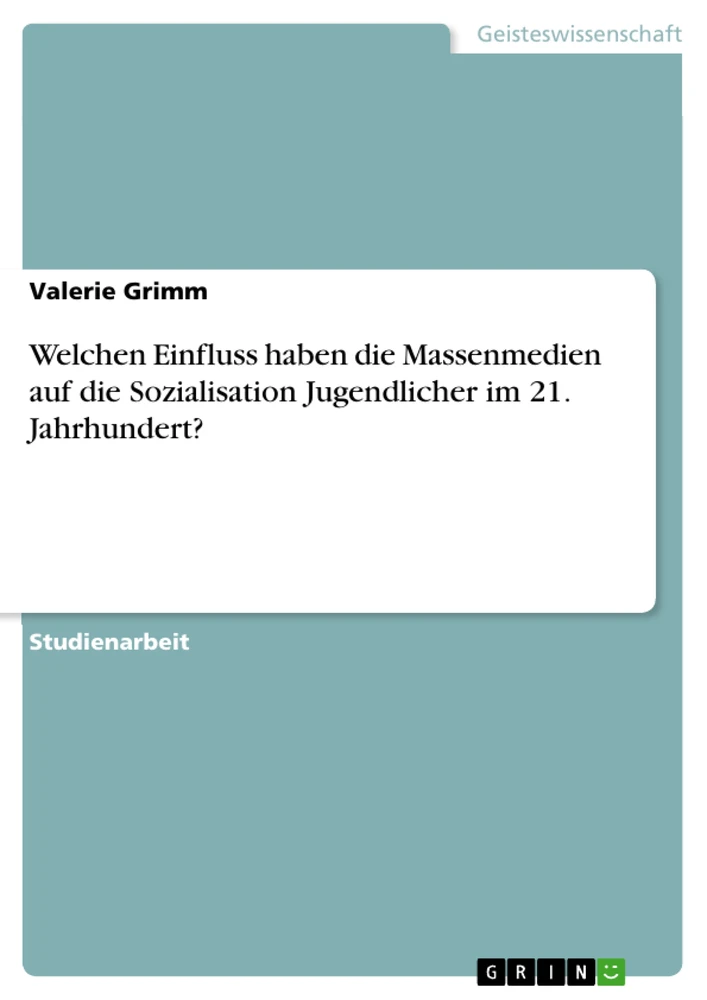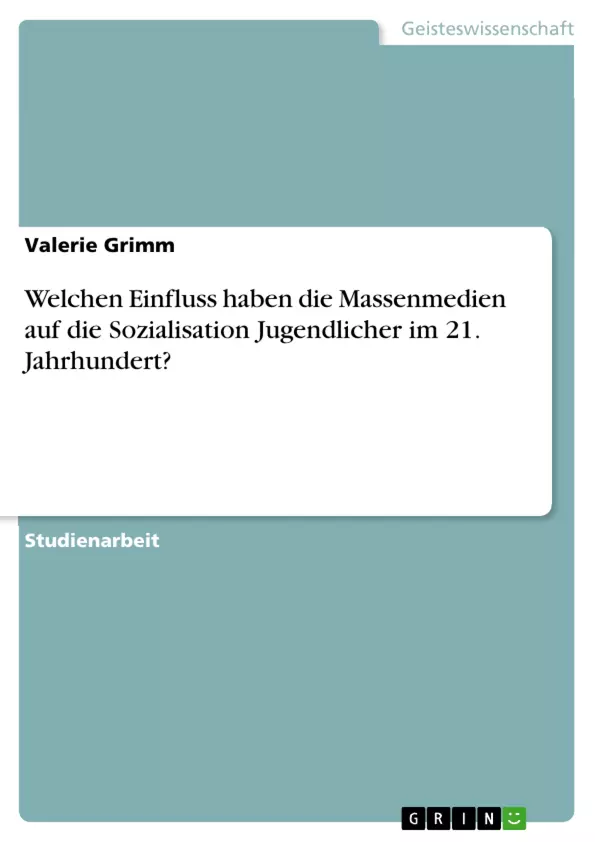Heutzutage sind Medien in unserem (Alltags-) Leben geradezu omnipräsent und kaum zu umgehen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wachsen Kinder und Jugendliche in einer von elektronischen Medien geprägten Umwelt auf; die Nutzung zahlreicher Massenmedien gehört längst zum Alltag. Dass Massenmedien einen erheblichen Einfluss auf Leben und Lebensgestaltung nehmen, ist unumstritten; gerade durch die Etablierung des Internets als Informations- und Kommunikationsmedium werden Jugendlich im Laufe ihrer Sozialisation stark beeinflusst. Durch das zügige Voranschreiten von Globalisierung und Modernisierung kommt es u.a. zu einer Vermischung von medialen und sozialen Aspekten, weshalb gerade in letzter Zeit immer mehr Wissenschaftler und Publizisten in Bezug auf die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts von einer „Mediengesellschaft“ sprechen; die Jugend gilt gar als „Netzgeneration“ oder „Generation @“.
Im Verlauf dieser Arbeit soll analysiert werden, ob und weshalb man heutzutage tatsächlich von einer mediatisierten bzw. medienvermittelten Sozialisation sprechen kann und welchen Einfluss die (Massen-) Medien auf den Sozialisationsprozess Jugendlicher im 21. Jahrhundert ausüben können. Dabei sollen auch die Risiken und Chancen einander gegenübergestellt werden, welche sich für Jugendliche beim „Konsum“ massenmedialer Angebote ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialisation
- Sozialisation im 21. Jahrhundert
- Jugend als Lebensphase
- (Massen-) Medien und Massenkommunikationsmittel
- Charakteristika und Funktionen von Medien
- Massenmedien und Gesellschaft - Mediengesellschaft?
- Medienkompetenz
- Sozialisation durch Massenmedien
- Chancen und Risiken
- Risiken.....
- Mediengewalt...
- Medienrealität und Weltsicht
- Konstruktive Wirkungen und Chancen
- Chancen und Risiken
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss der Massenmedien auf die Sozialisation Jugendlicher im 21. Jahrhundert. Die zentrale Fragestellung ist, ob und weshalb man heute von einer mediatisierten bzw. medienvermittelten Sozialisation sprechen kann und welchen Einfluss die Medien auf den Sozialisationsprozess Jugendlicher ausüben. Die Arbeit analysiert die Chancen und Risiken, die sich für Jugendliche durch den „Konsum“ massenmedialer Angebote ergeben.
- Sozialisation im Kontext der modernen Gesellschaft
- Die Rolle der Medien in der Sozialisation
- Die Auswirkungen der Medien auf die Jugend
- Chancen und Risiken der Mediennutzung
- Die Bedeutung von Medienkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die zentrale Forschungsfrage dar. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Sozialisation und die besonderen Herausforderungen der Sozialisation im 21. Jahrhundert. Kapitel 3 definiert die Lebensphase Jugend und ihre Besonderheiten. Kapitel 4 behandelt die Charakteristika und Funktionen von Massenmedien und die Entstehung einer "Mediengesellschaft". Kapitel 5 untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialisation durch Massenmedien und analysiert die Chancen und Risiken der Mediennutzung. Der Ausblick fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sozialisation, Massenmedien, Jugend, Mediennutzung, Mediengesellschaft, Medienkompetenz, Chancen und Risiken, und dem Einfluss von Medien auf die Entwicklung junger Menschen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Valerie Grimm (Author), 2009, Welchen Einfluss haben die Massenmedien auf die Sozialisation Jugendlicher im 21. Jahrhundert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181457