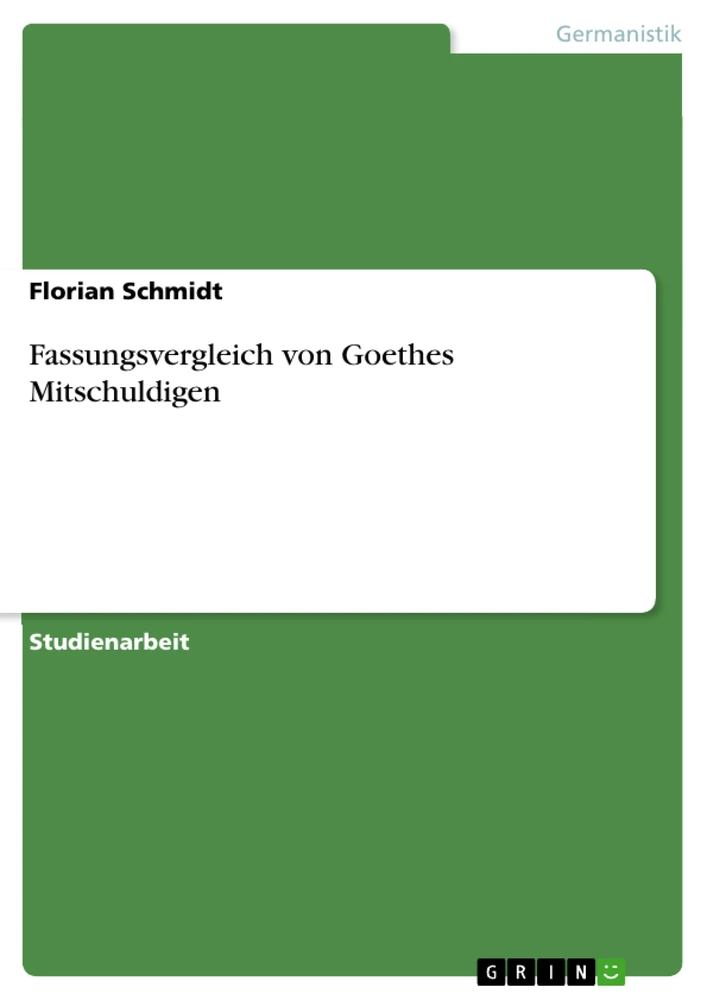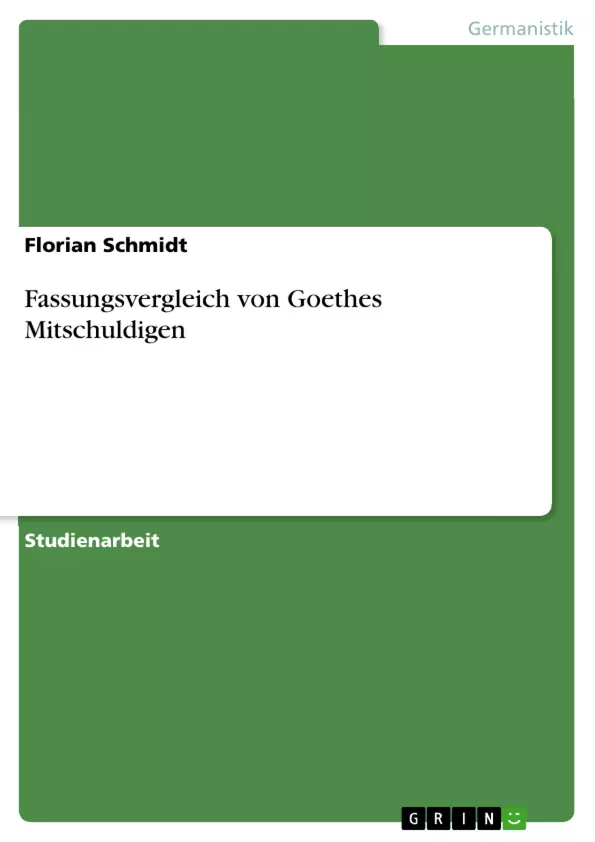In dieser Arbeit soll ein Fassungsvergleich von Goethes Lustspiel (Goethe hat dem Werk selbst den Namen Lustspiel gegeben, deswegen hier der Gebrauch des Terminus Lustspiel. Auf die genauere Typisierung der Mitschuldigen wird im Laufe der Arbeit noch eingegangen) „Die Mitschuldigen“ gemacht werden.
Das Hauptaugenmerk richtet sich auf die erste und zweite Fassung. Die dritte Fassung wird im Bezug auf die Analyse nur kurz angeschnitten, da es hier keine so große Veränderungen, wie von der ersten zur zweiten Fassung, gibt. Die erste Fassung besteht aus einem Akt, die zweite Fassung besteht aus drei Akten, wobei dort der eine Akt aus der ersten Fassung in zwei Akte aufgeteilt und ein neuer Expositionsakt davor gesetzt wurde. Der Plot ist in beiden Fassungen ähnlich. Der Expositionsakt dient vor allem dazu die Motivation der Handlungen darzulegen und den Text, im Sinne von Gottsched und Gellert, realistischer zu machen.
Doch zunächst zum Einakter. Die handelnden Personen sind der Wirt, seine Tochter Sophie, ihr Ehemann Söller und der Gast Alcest. Der Ort des Geschehens ist das Wirtshaus. Söller, „im Domino, den Hut auf, die Maske vor'm Gesicht, ohne Schuhe“1, befindet sich im Zimmer von Alcest, das dieser gemietet hat, um aus einer Schatulle Geld zu stehlen.
Er wird dabei allerdings von dem Wirt gestört, der auf der Suche nach einem Brief von Alcest ist, da er in diesem wichtigste politische Informationen vermutet. Bevor Söller von dem Wirt entdeckt wird, flieht er auf den Alkoven. Auch der Wirt kann seine Suche nach dem Brief nicht erfolgreich beenden, da er von Schritten von einem „Weiberschuh“2 unterbrochen wird. Er flieht aus dem Zimmer, aber in der Eile lässt er dabei seinen Wachsstock fallen.
Sophie betritt das leere Zimmer und wartet dort auf Alcest. Während sie auf ihn wartet spricht sie über ihre Liebe zu Alcest und über die Verfehlungen ihres Ehemanns Söller, der immer noch auf dem Alkoven sitzt und sich diesen Monolog anhören muss. Er kommentiert Sophies Worte, so dass es zu einem Dialog zwischen den Beiden kommt, der allerdings nur durch das Publikum beziehungsweise den Leser nachvollzogen werden kann.
Im vierten Auftritt kommt Alcest hinzu. Er und Sophie sprechen über ihre vergangene Liebe und Söller, immer noch in den Alkoven, fürchtet, dass er zum gehörnten Ehemann wird. Sophie besinnt sich allerdings auf ihre Tugendhaftigkeit und verlässt das Zimmer von Alcest. Dieser begleitet sie bis zur Haupttür und Söller nutzt die Gelegenheit um ...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die erste Fassung
- 2.1 Inhaltszusammenfassung
- 2.2 Entstehungsgeschichte
- 2.3 Biografische Interpretation
- 2.4 Die Komödie in Deutschland
- 2.5 Stil der Mitschuldigen
- 3. Die zweite Fassung
- 3.1 Inhaltszusammenfassung
- 3.2 Entstehungsgeschichte
- 3.3 Veränderungen
- 4. Die dritte Fassung
- 5. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die verschiedenen Fassungen von Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“, wobei der Fokus auf dem Vergleich der ersten und zweiten Fassung liegt. Die dritte Fassung wird nur kurz behandelt, da die Änderungen im Vergleich zur zweiten Fassung weniger umfangreich sind. Die Arbeit untersucht die Entstehungsgeschichte, den Inhalt und die stilistischen Besonderheiten der einzelnen Fassungen, um Entwicklungen im Schreibstil und den Intentionen Goethes nachzuvollziehen.
- Vergleich der verschiedenen Fassungen von „Die Mitschuldigen“
- Analyse der Entstehungsgeschichte und der damit verbundenen Kontextualisierung
- Untersuchung der stilistischen Entwicklung in Goethes Werk
- Biografische Interpretation der Thematik
- Einordnung des Stücks in den Kontext der deutschen Komödie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich einen Fassungsvergleich von Goethes „Die Mitschuldigen“ durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf dem Vergleich der ersten und zweiten Fassung liegt. Die dritte Fassung wird nur marginal betrachtet, da die Veränderungen gegenüber der zweiten Fassung weniger gravierend sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die erste Fassung ein Einakter, die zweite ein Dreiakter ist, und die Unterschiede in der Handlungsstruktur kurz erläutert.
2. Die erste Fassung: Dieses Kapitel befasst sich mit der ersten Fassung von Goethes „Die Mitschuldigen“, einem Einakter. Es wird eine detaillierte Inhaltszusammenfassung geliefert, die die Handlung, die beteiligten Charaktere (Wirt, Tochter Sophie, ihr Ehemann Söller und Gast Alcest) und den Schauplatz (Wirtshaus) beschreibt. Die Entstehungsgeschichte wird beleuchtet, wobei die Unsicherheiten bezüglich der genauen Datierung und der Entdeckung der ersten Fassung nach über hundert Jahren diskutiert werden. Der biographische Kontext und die Einordnung des Stücks in die damalige deutsche Komödie werden ebenfalls analysiert, mit Bezugnahme auf relevante Forschungsliteratur. Der Stil der ersten Fassung wird untersucht und seine Eigenheiten herausgestellt.
3. Die zweite Fassung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die zweite, dreiaktige Fassung von „Die Mitschuldigen“. Die Inhaltszusammenfassung wird präsentiert, die die Erweiterungen und Veränderungen im Vergleich zur ersten Fassung hervorhebt. Die Entstehungsgeschichte wird im Detail betrachtet, unter Einbezug von Informationen über den Kontext der Entstehung (z.B. der türkisch-russische Krieg) und die Diskussion um die genaue Datierung. Die Kapitel analysieren die wesentlichen Änderungen zwischen der ersten und zweiten Fassung, unter Berücksichtigung der hinzugefügten Exposition und deren Funktion innerhalb des Stücks. Die Analyse betrachtet die Auswirkungen dieser strukturellen Veränderungen auf die Handlung und Charakterentwicklung.
Schlüsselwörter
Goethe, Die Mitschuldigen, Fassungsvergleich, Entstehungsgeschichte, deutsche Komödie, biografische Interpretation, Stilanalyse, Einakter, Dreiakter, Lustspiel.
Goethes "Die Mitschuldigen": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die verschiedenen Fassungen von Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“, mit besonderem Fokus auf den Vergleich der ersten und zweiten Fassung. Die dritte Fassung wird kurz behandelt. Die Analyse umfasst die Entstehungsgeschichte, den Inhalt, die stilistischen Besonderheiten und die Intentionen Goethes.
Welche Fassungen von "Die Mitschuldigen" werden verglichen?
Der Hauptfokus liegt auf dem Vergleich der ersten und zweiten Fassung. Die dritte Fassung wird nur marginal berücksichtigt, da die Änderungen gegenüber der zweiten Fassung weniger gravierend sind.
Wie unterscheiden sich die erste und zweite Fassung?
Die erste Fassung ist ein Einakter, die zweite ein Dreiakter. Die Arbeit beschreibt detailliert die Inhaltszusammenfassungen beider Fassungen und hebt die Erweiterungen und Veränderungen in der Handlung, den Charakteren und der Struktur hervor. Die hinzugefügte Exposition in der zweiten Fassung und deren Funktion werden analysiert.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse umfasst die Entstehungsgeschichte beider Fassungen, inklusive Kontextualisierung (z.B. der türkisch-russische Krieg), Inhaltszusammenfassungen, stilistische Besonderheiten, biografische Interpretationen und die Einordnung des Stücks in den Kontext der deutschen Komödie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur ersten Fassung, ein Kapitel zur zweiten Fassung, ein Kapitel zur dritten Fassung und eine abschließende Betrachtung. Jedes Kapitel bietet eine Inhaltszusammenfassung und analysiert die jeweiligen Aspekte der jeweiligen Fassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Die Mitschuldigen, Fassungsvergleich, Entstehungsgeschichte, deutsche Komödie, biografische Interpretation, Stilanalyse, Einakter, Dreiakter, Lustspiel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Fassungen von "Die Mitschuldigen" zu vergleichen, um Entwicklungen im Schreibstil und den Intentionen Goethes nachzuvollziehen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Veränderungen zwischen der ersten und zweiten Fassung.
Wie wird die dritte Fassung behandelt?
Die dritte Fassung wird nur kurz behandelt, da die Änderungen im Vergleich zur zweiten Fassung weniger umfangreich sind.
Welche Charaktere sind in "Die Mitschuldigen" relevant?
Die relevanten Charaktere sind der Wirt, seine Tochter Sophie, ihr Ehemann Söller und der Gast Alcest.
Wo spielt das Stück?
Das Stück spielt in einem Wirtshaus.
- Quote paper
- Dottore Florian Schmidt (Author), 2009, Fassungsvergleich von Goethes Mitschuldigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181547