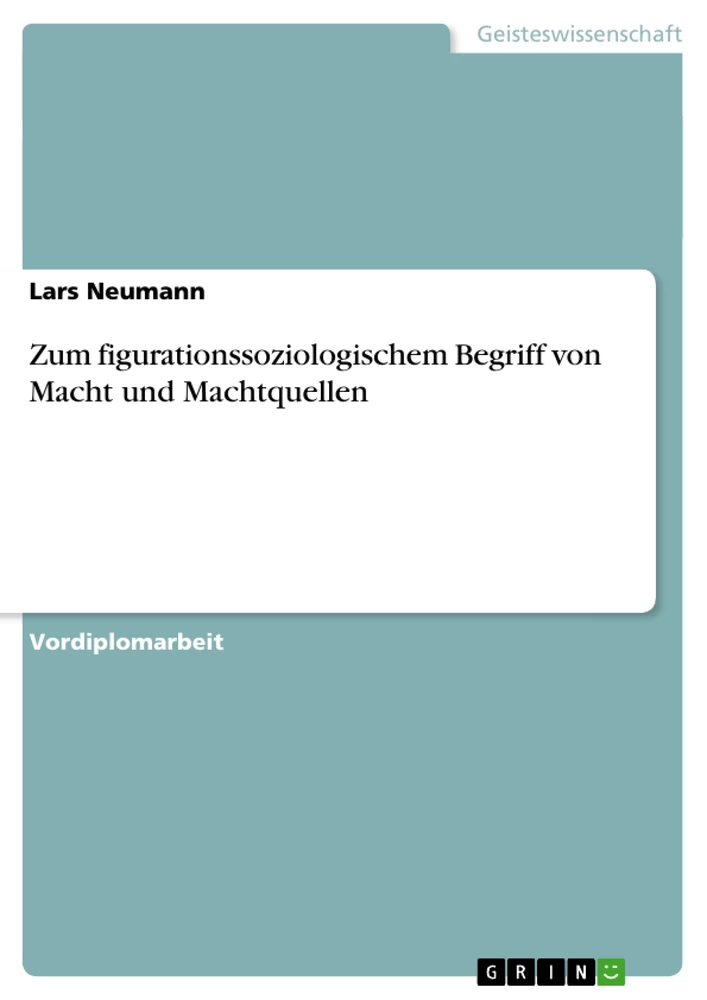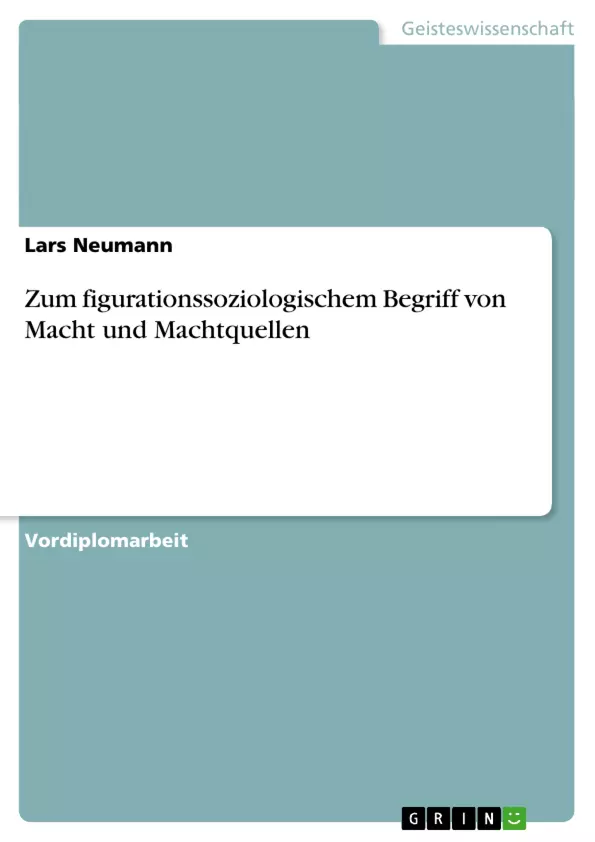Menschen leben schon sehr lange miteinander auf diesem Planeten. Der
technische Fortschritt stößt in immer höhere Sphären, jedoch sind die
Beziehungen zwischen den Menschen immer noch mit einem Nebelschleier
verdeckt, der uns oftmals noch heute an magische und mythische Ideologien
glauben lässt. Wie wäre es angemessener, menschliche Beziehungen und
Verhaltensweisen zu beschreiben und zu erklären?
Norbert Elias (1897 – 1990) bietet mit der Prozess – und Figurationssoziologie
einen Ansatz, der den Menschen nicht als vereinzeltes Wesen, sondern als ein mit
anderen Menschen bildende Interdependenzgeflechte versteht. Menschen sind zeit
ihrer Geburt aufeinander angewiesen und somit voneinander abhängig, aus diesem
Grund üben sie auch „Macht“ aufeinander aus.
Aber was ist „Macht“ überhaupt? Gibt es Menschen, die keine „Macht“ haben.
Und kann man „Macht“ überhaupt besitzen, wie zum Beispiel ein Stück Seife?
Was haben in früheren Zeiten die Menschen unter „Macht“ verstanden, wie wird
es heute gesehen und wie wäre es vielleicht, ausgehend vom Menschenbild von
Norbert Elias, angemessener zu formulieren, um so Geschehenszusammenhänge
zwischen Menschen besser erklären zu können, damit man vielleicht einmal
Konflikte im Ansatz entschärfen kann?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Menschenbild der Prozess- und Figurationssoziologie
- 2.1. Angewiesenheiten der Menschen
- 2.2. Wandelbarkeit der Menschen
- 2.2.1. Über den Wandel des Essens anhand des Gebrauchs der Gabel
- 2.3. Menschliche Bindungen
- 3. „Macht“ – Struktureigentümlichkeit jeder menschlichen Beziehung
- 3.1. Begriffsgeschichte von „Macht“
- 3.2. „Macht“ als Beziehungsbegriff
- 3.3. Wandelbarkeit von Machtbalancen
- 3.3.1. „Spielmodelle“
- 3.3.1.1. Zweipersonenspiele
- 3.3.1.2. Vielpersonenspiele auf einer Ebene
- 3.3.1.3. Vielpersonenspiele auf mehreren Ebenen
- 3.3.1.4. Zweistöckiges Spielmodell – Oligarchischer Typ
- 3.3.1.5. Zweistöckiges Spielmodell – Vereinfachter Demokratisierungstyp
- 3.3.1. „Spielmodelle“
- 3.4. Machtquellen
- 3.5. Strukturmerkmale von Etablierten - Außenseiter - Beziehungen
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den figurationssoziologischen Begriff von Macht und Machtquellen. Sie zielt darauf ab, das Verständnis von Machtbeziehungen im Kontext der Prozess- und Figurationssoziologie zu vertiefen und die Dynamik von Machtbalancen zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Betrachtung des Menschen nicht als isolierte Einheit, sondern als Teil eines komplexen Netzes von Interdependenzen.
- Das Menschenbild der Prozess- und Figurationssoziologie
- Der Beziehungsbegriff von Macht
- Wandelbarkeit von Machtbalancen und Spielmodelle
- Machtquellen und ihre Dynamik
- Strukturmerkmale von Etablierten-Außenseiter-Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach einer angemessenen Beschreibung und Erklärung menschlicher Beziehungen im Kontext des technischen Fortschritts. Sie präsentiert Norbert Elias' Prozess- und Figurationssoziologie als einen Ansatz, der die Interdependenz von Menschen betont und die Ausübung von Macht untereinander thematisiert. Die Arbeit fragt nach der Definition von Macht, ihrem historischen Verständnis und nach Möglichkeiten, Konflikte durch ein besseres Verständnis von Machtbeziehungen zu entschärfen.
2. Das Menschenbild der Prozess- und Figurationstheorie: Dieses Kapitel beschreibt das Menschenbild der Prozess- und Figurationssoziologie, das den Menschen als in Interdependenzgeflechte eingebunden darstellt, im Gegensatz zum individualistischen "homo clausus"-Modell. Es betont die Angewiesenheit von Menschen aufeinander, insbesondere die Überlebensabhängigkeit des neugeborenen Menschen. Die Wandelbarkeit des Menschen und die Bedeutung des Lernens für die soziale Integration werden hervorgehoben, wobei die Rolle von Symbolen und Kommunikation im Aufbau und der Dynamik von Figurationen im Mittelpunkt steht.
3. „Macht“ – Struktureigentümlichkeit jeder menschlichen Beziehung: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Macht“ aus figurationssoziologischer Perspektive als Beziehungsbegriff. Es beleuchtet die Begriffsgeschichte von Macht und diskutiert die Wandelbarkeit von Machtbalancen mithilfe von Spielmodellen (Zweipersonen-, Vielpersonenspiele auf einer oder mehreren Ebenen). Die verschiedenen Spielmodelle veranschaulichen die Komplexität von Machtstrukturen und die Möglichkeit von Veränderungen innerhalb dieser Strukturen. Schließlich werden Machtquellen und die Strukturmerkmale von Etablierten-Außenseiter-Beziehungen behandelt.
Schlüsselwörter
figurationssoziologie, Macht, Machtquellen, Interdependenz, Spielmodelle, Machtbalancen, Menschenbild, Norbert Elias, Angewiesenheit, Wandelbarkeit, Etablierte, Außenseiter, Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Prozess- und Figurationssoziologie: Macht und Machtquellen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den figurationssoziologischen Begriff von Macht und Machtquellen. Sie zielt darauf ab, das Verständnis von Machtbeziehungen im Kontext der Prozess- und Figurationssoziologie zu vertiefen und die Dynamik von Machtbalancen zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Betrachtung des Menschen nicht als isolierte Einheit, sondern als Teil eines komplexen Netzes von Interdependenzen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Menschenbild der Prozess- und Figurationssoziologie, den Beziehungsbegriff von Macht, die Wandelbarkeit von Machtbalancen und Spielmodelle, Machtquellen und ihre Dynamik sowie die Strukturmerkmale von Etablierten-Außenseiter-Beziehungen.
Welches Menschenbild wird vertreten?
Die Arbeit vertritt das Menschenbild der Prozess- und Figurationssoziologie, welches den Menschen als in Interdependenzgeflechte eingebunden darstellt, im Gegensatz zum individualistischen "homo clausus"-Modell. Es betont die Angewiesenheit von Menschen aufeinander und die Wandelbarkeit des Menschen durch Lernen und soziale Integration.
Wie wird der Begriff „Macht“ definiert?
Der Begriff „Macht“ wird aus figurationssoziologischer Perspektive als Beziehungsbegriff analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Begriffsgeschichte von Macht und diskutiert die Wandelbarkeit von Machtbalancen mithilfe von Spielmodellen (Zweipersonen-, Vielpersonenspiele auf einer oder mehreren Ebenen).
Welche Rolle spielen Spielmodelle?
Die verschiedenen Spielmodelle (Zweipersonenspiele, Vielpersonenspiele auf einer oder mehreren Ebenen, zweistöckige Modelle) veranschaulichen die Komplexität von Machtstrukturen und die Möglichkeit von Veränderungen innerhalb dieser Strukturen.
Was sind die zentralen Konzepte der Arbeit?
Zentrale Konzepte sind Figurationssoziologie, Macht, Machtquellen, Interdependenz, Spielmodelle, Machtbalancen, Menschenbild, Angewiesenheit, Wandelbarkeit, Etablierte, Außenseiter und Beziehungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Menschenbild der Prozess- und Figurationssoziologie, ein Kapitel zu „Macht“ als Beziehungsbegriff, und einen Schluss. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten des Themas Macht und Machtbeziehungen im Kontext der Figurationssoziologie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis von Machtbeziehungen im Kontext der Prozess- und Figurationssoziologie zu vertiefen und die Dynamik von Machtbalancen zu analysieren. Sie möchte ein besseres Verständnis von Machtbeziehungen ermöglichen, um Konflikte zu entschärfen.
Wer ist der Autor und was ist die Quelle?
Die Quelle der Informationen ist ein von einer Verlagsgesellschaft bereitgestellter Text, der OCR-Daten enthält und nur für akademische Zwecke zur Analyse von Themen verwendet werden darf. Der Name des Autors wird nicht genannt.
- Citation du texte
- Lars Neumann (Auteur), 2003, Zum figurationssoziologischem Begriff von Macht und Machtquellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18156