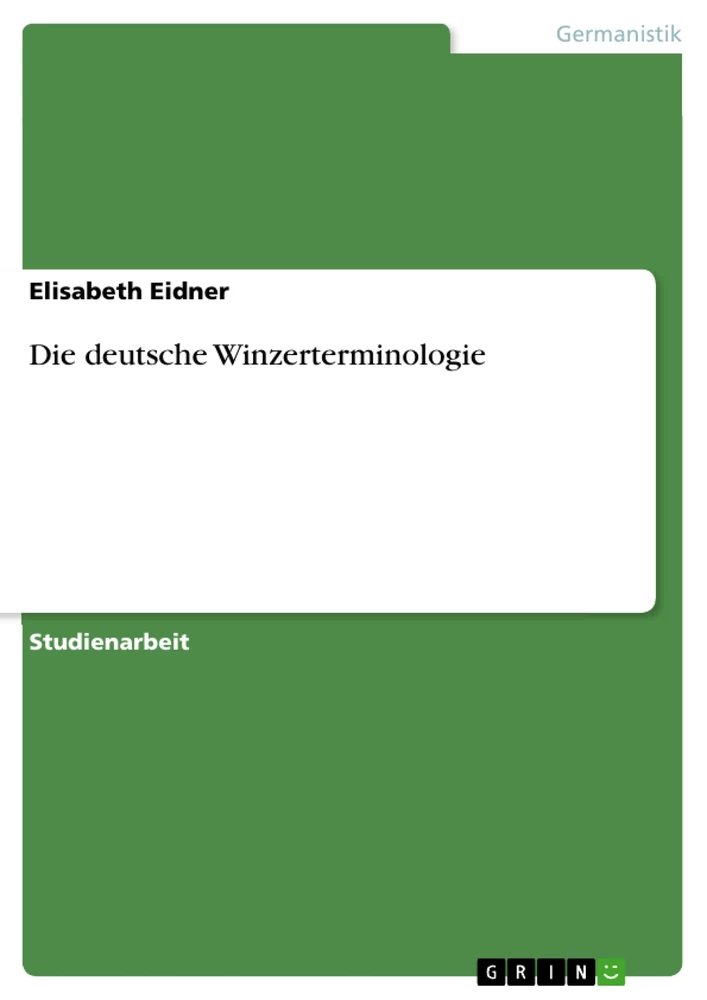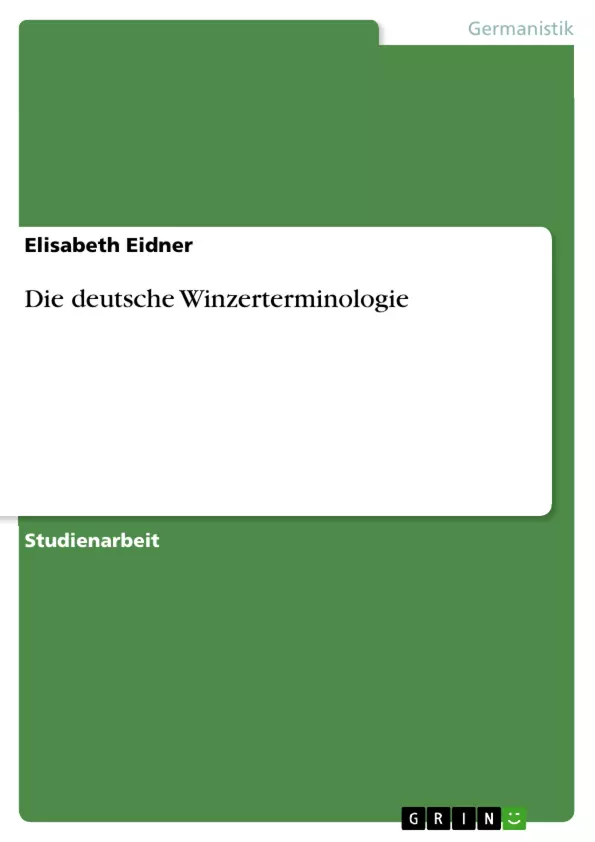Die heilende Wirkung des Weines ist schon seit Jahrhunderten bekannt doch auch
andere Eigenschaften des Rebensaftes sind seit jeher sehr begehrt. Als Getränk der
Götter und zum Teil als Grabbeigabe verwendet, genoss der Wein schon bei frühen
Kulturen hohes Ansehen. Die Jahrtausende alte Tradition des Weingenusses und -gebrauchs
und die dazugehörigen Arbeiten des Anbaus und der Verarbeitung der Reben
wecken das Interesse für diesen Handwerkszweig.
Für das Winzerhandwerk entstand eine spezifische Fachterminologie, die sich auch
heute noch stetig weiterentwickelt. An jeden technologischen Fortschritt ist auch eine
Anpassung der entsprechenden Termini geknüpft. Als praktisches Beispiel hierfür sei
das Rebmesser genannt, welches zum Beschneiden des Weinstrauchs verwendet wurde.
Seit einiger Zeit wird hierfür allerdings die weitaus praktischere Rebschere benutzt, was
zu Folge hatte, dass dieser Terminus Einzug in die Winzersprache hielt. Besonders
auffällig sind auch die zum Teil sehr starken regionalen Unterschiede im Wortschatz der
Winzer. Die Geschichte des Weinbaus und die damit einhergehende Entwicklung der
Winzerterminologie werden Inhalt der ersten beiden Kapitel der vorliegenden Hausarbeit
sein.
Die beiden darauffolgenden Kapitel sind einem herausragenden linguistischen Projekt
gewidmet, dem Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzerterminologie von Wolfgang
Kleiber. Als Nachfolgeprojekt dazu ist auch das Wörterbuch der deutschen Winzersprache
erwähnenswert, welches die gesammelten Materialien lexikographisch aufarbeitet.
Die zweite Teil dieser Hausarbeit umfasst die praktische Textanalyse eines mittelhochdeutschen
Textes zum Thema Wein. Dieser wird auf eventuelle fachsprachliche
Besonderheiten in Struktur, Syntax und Terminologie untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Theorie
- 1.1 Überblick über die Geschichte des Weinbaus in Deutschland
- 1.2 Die deutsche Winzerterminologie
- a) zeitliche Entwicklung
- b) regionale Unterschiede
- 1.3 Der Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzerterminologie
- 1.4 Das Wörterbuch der deutschen Winzersprache
- II. Textanalyse
- 2.1 Textstruktur
- 2.2 Syntax
- 2.3 Terminologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die deutsche Winzerterminologie, ihre historische Entwicklung und regionale Variationen. Sie analysiert ein mittelhochdeutsches Textbeispiel auf fachsprachliche Besonderheiten in Struktur, Syntax und Terminologie. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des „Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzerterminologie“ und des „Wörterbuchs der deutschen Winzersprache“ als bedeutende linguistische Projekte.
- Geschichte des deutschen Weinbaus
- Entwicklung der deutschen Winzerterminologie
- Regionale Unterschiede in der Winzerterminologie
- Analyse eines mittelhochdeutschen Weintextes
- Die Rolle des „Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzerterminologie“ und des „Wörterbuchs der deutschen Winzersprache“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Bedeutung des Weinbaus und die Entwicklung einer spezifischen Fachterminologie. Kapitel I.1 bietet einen Überblick über die Geschichte des Weinbaus in Deutschland, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Kapitel I.2 befasst sich mit der deutschen Winzerterminologie, ihrer zeitlichen Entwicklung und den regionalen Unterschieden. Es werden wichtige Quellen und Projekte zur Erforschung der Winzerterminologie erwähnt, wie der Wortatlas und das Wörterbuch der deutschen Winzersprache. Kapitel II behandelt die geplante Textanalyse eines mittelhochdeutschen Textes bezüglich fachsprachlicher Aspekte.
Schlüsselwörter
Deutsche Winzerterminologie, Weinbaugeschichte, regionale Variationen, mittelhochdeutscher Text, Wortatlas, Wörterbuch, Fachsprache, Lexikographie, Weinbau, historische Fachsprache.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Eidner (Autor:in), 2010, Die deutsche Winzerterminologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181564