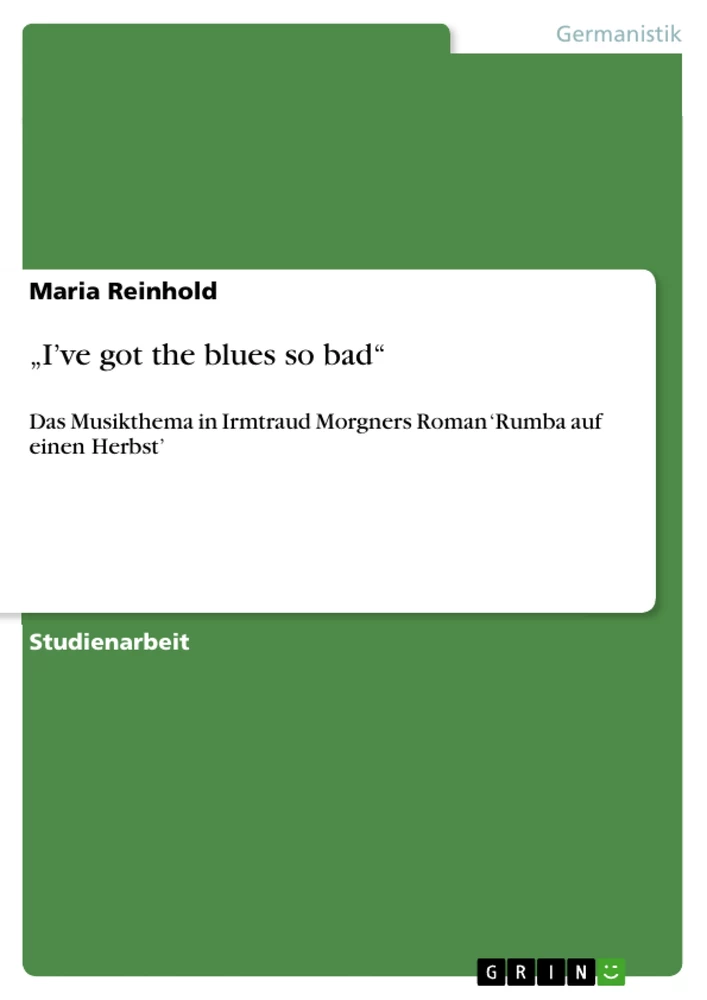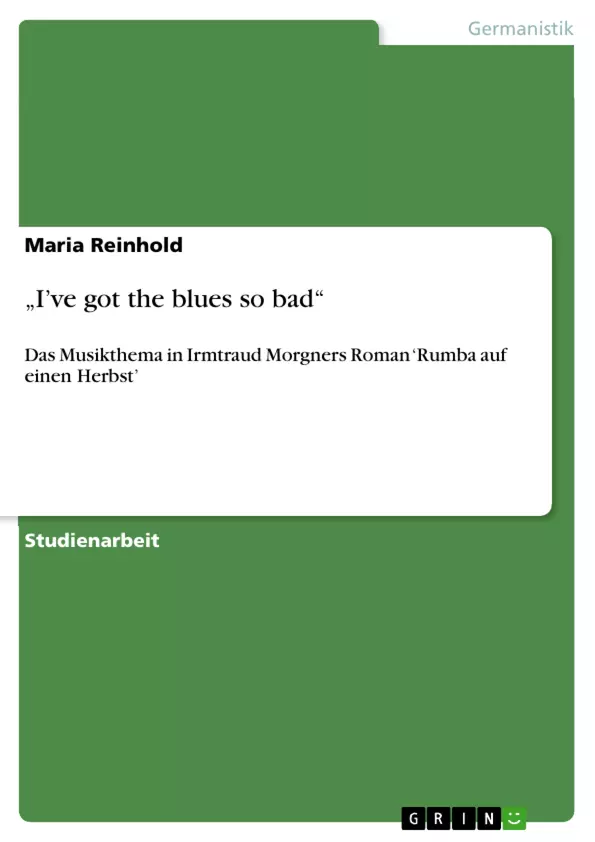Der Roman „Rumba auf einen Herbst“ der 1990 verstorbenen Autorin Irmtraud Morgner wurde 1963 und 1965 vom Aufbau Verlag, „einem der bedeutendsten belletristischen Buchverlage in der DDR“ abgelehnt, da er in beiden Versionen nicht im Sinne des Bitterfelder Programms war. Drei Hauptaufgaben bestimmten dieses neue Kulturprogramm der DDR: die
Arbeiterklasse sollte die „‘Höhen der Kultur erstürmen‘“, die „‘Kluft zwischen Kunst und Leben‘“ sollte überwunden werden und der „Weg zu ‚gebildeten Nation‘“ sollte geebnet werden. So sollte ein allgemeines sozialistisches Bewusstsein geschaffen werden, und Autoren
hatten die Aufgabe, am „Alltag der Arbeiter teilzunehmen, sie zum Schreiben zu motivieren und über ihr Leben zu berichten.“ Dieses Parteiprogramm ist allerdings ein zweischneidiges Schwert: Arbeiter und Künstler, besonders Berufsschriftsteller, werden zwar zusammengeführt,
aber der SED war auch die Möglichkeit gegeben, das Schaffen der Autoren
zu überwachen und systemkritische Texte zu unterbinden. So, wie es im Falle von Irmtraud Morgners Roman geschah.
In der Begründung aus dem Jahre 1963 heißt es unter anderem sinngemäß, dass die Tanzszene im ersten Kapitel keine glaubhafte Grundlage für den Schluss liefert, und dass ihre Figurenzeichnung
nicht einheitlich gestaltet ist. Konkret im Sinne des Bitterfelder Wegs ist der Vorwurf bezüglich eines Fehlens eines „auktorialen Werturteils“, auf das Morgner auch an anderen Stellen verzichtet. Den Figuren fehlt „die positiv bestimmende Kraft“, also eine Kraft im sozialistischen Sinne, die die Volksgenossen zusammenhält und auf einer Linie gehen lässt.
Zwei Jahre später reichte Morgner das abgeänderte Manuskript bei Mitteldeutschen Verlag in Halle ein. Zur gleichen Zeit geriet die Beat-Bewegung, die große Teile der Jugendlichen erfasst hatte, in den Fokus der SED. Sie wurde als Auslöser und Anlass für Staatsfeindlichkeit und Sittenverfall deklariert, Künstlern wurde die Verantwortung für die Erziehung der Jugend übertragen. Folgen waren Auftrittsverbote, Verleumdungskampagnen und ähnliches. Für ‚Rumba auf einen Herbst‘ bedeuteten die Richtlinien des 11. ZK der SED – nämlich die Verurteilung
von Skeptizismus, Nihilismus und Individualismus – die endgültige Ablehnung.
Morgner notierte dazu: „‘Begründung der Zensur war: skeptizistisch durch und durch bis zum Nihilismus, ein Buch des enthemmten Individualismus.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbemerkungen
- Methodik
- Aufbau des Romans und das Musikthema
- Blues
- Schalmeientwist
- Notturno
- Cantus firmus
- Konflikte
- Geschlechterkonflikte
- Generationskonflikte
- Wissenschaftler vs. Arbeiter
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Irmtraud Morgners Roman "Rumba auf einen Herbst" mit Fokus auf dessen Aufbau und die Bedeutung des musikalischen Themas. Es wird geprüft, inwieweit der Roman einem Sonatenaufbau folgt und die drei Hauptkonfliktlinien – Geschlechterkonflikte, Generationskonflikte und Konflikte zwischen Wissenschaft und Sozialismus – analysiert.
- Der Sonatenaufbau des Romans
- Die Bedeutung des Musikthemas als Strukturprinzip
- Analyse der Geschlechterkonflikte im Roman
- Die Darstellung von Generationskonflikten
- Der Konflikt zwischen Wissenschaft und Sozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Romans und seine Ablehnung durch den Aufbau Verlag im Kontext des Bitterfelder Programms. Die Methodik beschreibt den Ansatz der Arbeit, insbesondere die Untersuchung des Sonatenaufbaus und der drei Hauptkonfliktlinien. Der zweite Abschnitt analysiert den Aufbau des Romans als viersätzige Sonate, wobei die einzelnen Sätze (Blues, Schalmeientwist, Notturno, Cantus firmus) und ihre thematische Verknüpfung untersucht werden. Der "Blues"-Abschnitt wird als Allegro einer Sonate detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Irmtraud Morgner, Rumba auf einen Herbst, Sonatenform, Musikthema, Geschlechterkonflikte, Generationskonflikte, Wissenschaft vs. Sozialismus, Bitterfelder Programm, DDR-Literatur, Sozialistische Gesellschaft.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Maria Reinhold (Author), 2011, „I’ve got the blues so bad“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181588