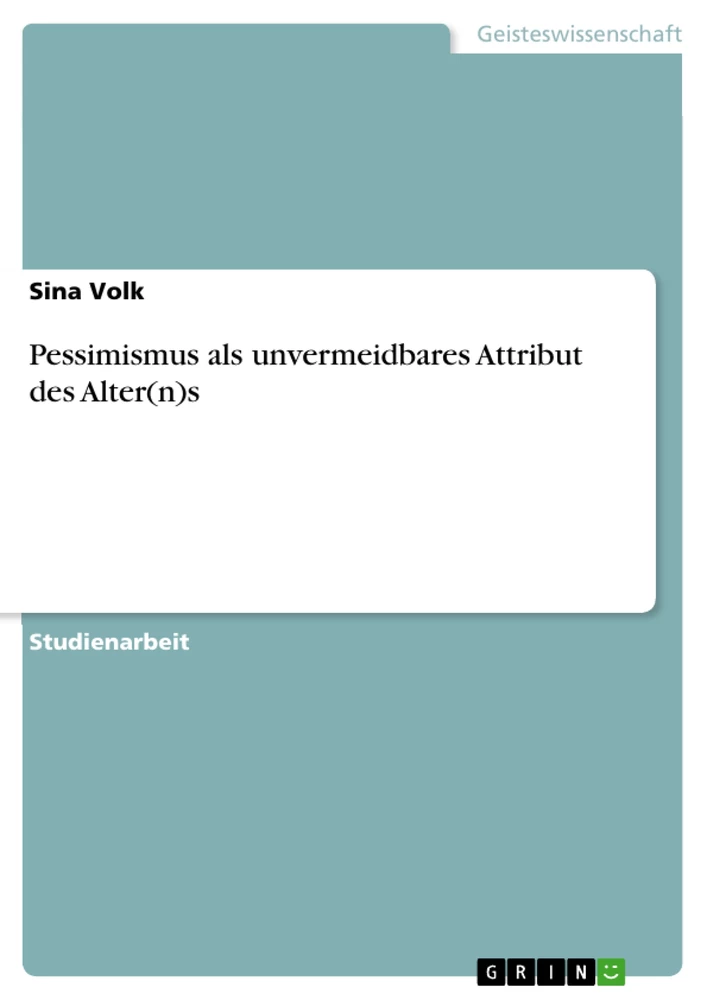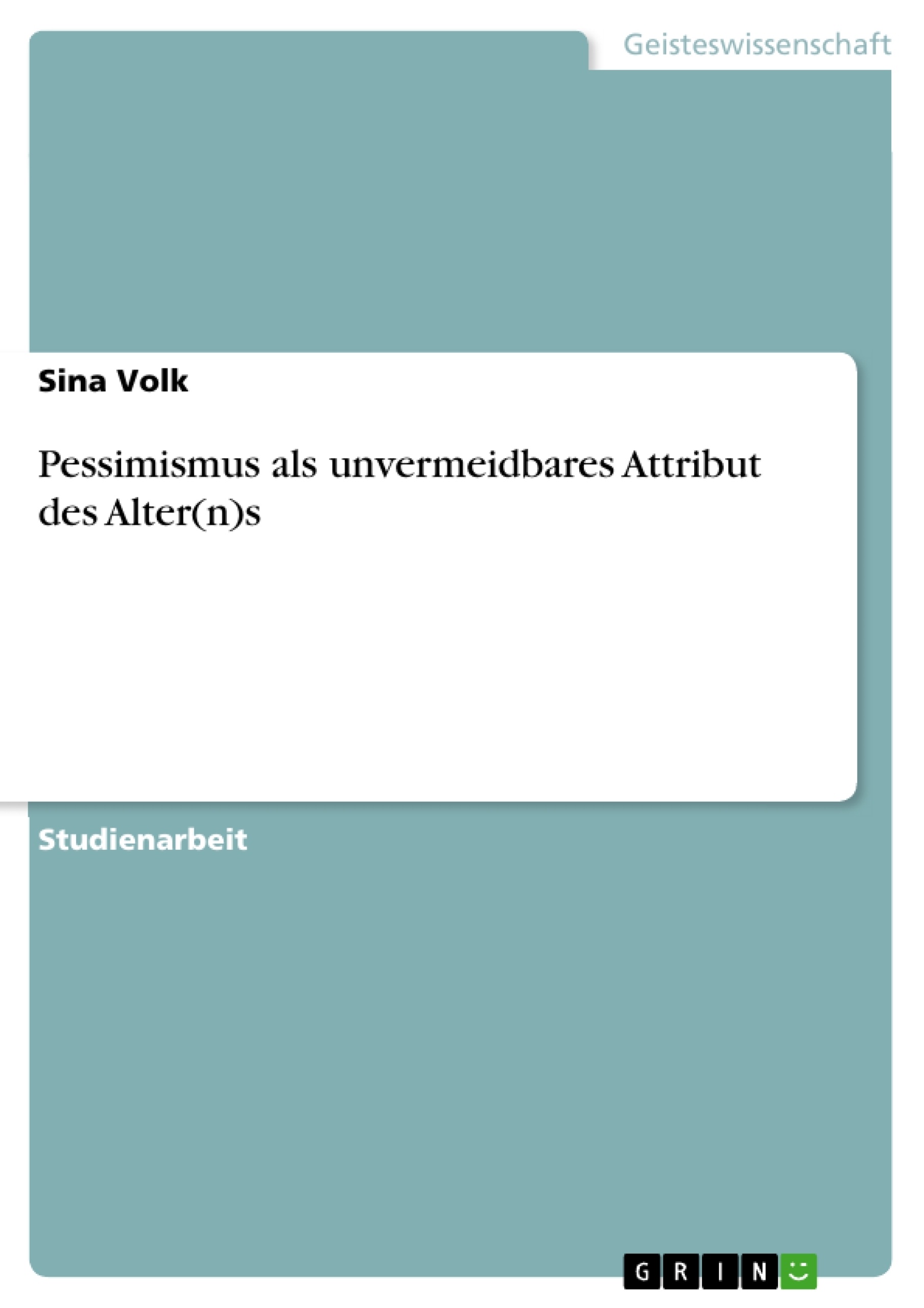„Ist sonach der Charakter der ersten Lebenshälfte unbefriedigte Sehnsucht nach Glück; so ist der der zweiten Besorgniß vor Unglück.“
Diese pessimistische Ansicht über das Wesen der Jugend sowie das Wesen des Alters äußerte Arthur Schopenhauer (1788-1860) in seinem Werk „Vom Unterschiede der Lebensalter“ 1851. Seine Aussage beläuft sich darauf, dass der Mensch, während er in der Jugend hoffnungsvoll nach dem Glück strebt, im Alter hingegen eingesehen hat, dass er selbiges nicht erreichen kann, weshalb er enttäuscht ist und resigniert.
Das Zitat beschreibt eine von vielen möglichen Meinungen über das Alter(n) und gerade in der heutigen Zeit, in welcher dem Jugendkult gefrönt und das Alter verpönt wird, scheint sie nicht an Diskussionswert einzubüßen. So schrieb auch Simone de Beauvoir über einhundert Jahre später in ihrem Werk „Das Alter“ über den alternden Menschen:
„Ob die Literatur ihn rühmt oder verächtlich macht, in jedem Fall begräbt sie ihn unter Schablonen. Sie verbirgt ihn, anstatt ihn zu enthüllen. Er wird, im Vergleich mit der Jugend und dem reifen Alter, als eine Art Gegenbild gesehen: Er ist nicht mehr der Mensch selbst, sondern seine Grenze; er steht am Rande des menschlichen Schicksals; man erkennt es nicht wieder, man erkennt sich nicht in ihm.“
Sie verweist auf die stereotype Einordnung der Menschen nach ihrem Alter und spielt zudem auf die Diskriminierung älterer Menschen gerade in der heutigen westlichen Gesellschaft an.
Diese Äußerung spiegelt zudem nicht nur die zahlreichen Wandlungen der Ansichten über das Alter des Menschen aus philosophischer Perspektive seit der Antike wider, sondern drückt gleichzeitig auch aus, dass eine erschöpfende Analyse und befriedigende Interpretation der Schwierigkeiten und Möglichkeiten, die das Alter mit sich bringt, kaum möglich ist. Der Grundtenor ist ein negativer, pessimistischer – ist dies unumgänglich bei der Betrachtung des Alters und des Alterungsprozesses? Um dies zu beantworten, möchte ich im Folgenden zunächst auf die historische Entwicklung der Ansichten über das Alter eingehen und daraufhin Schopenhauers Auffassung zum Alter darstellen, analysieren und in einen Kontext zur gegenwärtigen Situation setzen. Inwiefern ist Schopenhauers Weltsicht realistisch? Ist die Ausprägung einer pessimistischen Perspektive unvermeidbar angesichts der negativen Aspekte des Alter(n)s?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Lebensalter in der Philosophie - Historischer Überblick
- III. Schopenhauer: Vom Unterschiede der Lebensalter
- 3.1. Zusammenfassung der Thesen
- 3.2. Analyse und Interpretation
- IV. Philosophisch-anthropologische Aspekte des Alter(n)s
- 4.1. Pessimismus
- 4.2. Aspekte des Alter(n)s
- 4.3. Perspektiven
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These, dass Pessimismus ein unvermeidliches Attribut des Alterns ist. Sie beleuchtet historische Perspektiven auf das Alter in der Philosophie, analysiert Schopenhauers Sichtweise und setzt diese in den Kontext der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wahrnehmung. Die Arbeit fragt nach dem Realitätsgehalt von Schopenhauers pessimistischer Weltsicht und der Unvermeidbarkeit eines pessimistischen Blicks angesichts der negativen Aspekte des Alterns.
- Historische Entwicklung der philosophischen Ansichten zum Alter
- Schopenhauers These vom Unterschied der Lebensalter: Analyse und Interpretation
- Philosophisch-anthropologische Aspekte des Alterns
- Der Einfluss von Pessimismus auf die Wahrnehmung des Alterns
- Gegenwärtige gesellschaftliche Perspektiven auf das Altern
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Unvermeidbarkeit von Pessimismus im Alter vor und benennt die methodischen Schritte der Arbeit. Sie verweist auf die gegensätzlichen Sichtweisen auf das Altern, von der idealisierten Sichtweise bis hin zu einer pessimistischen Einschätzung.
II. Lebensalter in der Philosophie - Historischer Überblick: Dieses Kapitel bietet einen kurzen geschichtlichen Überblick über unterschiedliche philosophische Ansichten zum Alter, beginnend mit der Antike. Es werden die gegensätzlichen Positionen von Denkern wie Cicero, Aristoteles und Euripides bezüglich der Bewertung des Alters und seiner Phasen dargestellt.
III. Schopenhauer: Vom Unterschiede der Lebensalter: Hier wird Schopenhauers Sicht auf die verschiedenen Lebensalter und die damit verbundenen emotionalen und philosophischen Aspekte detailliert dargestellt und analysiert. Die zentralen Thesen Schopenhauers werden zusammengefasst und interpretiert.
IV. Philosophisch-anthropologische Aspekte des Alter(n)s: Dieser Abschnitt befasst sich mit philosophisch-anthropologischen Aspekten des Alterns, wobei der Pessimismus als ein möglicher Aspekt betrachtet wird. Die verschiedenen Aspekte des Alterns werden beleuchtet und in Relation zur pessimistischen Sichtweise gesetzt.
Schlüsselwörter
Alter, Altern, Pessimismus, Philosophie, Lebensalter, Schopenhauer, Historischer Überblick, Philosophische Anthropologie, Altersdiskriminierung, Lebensqualität.
- Citar trabajo
- Sina Volk (Autor), 2011, Pessimismus als unvermeidbares Attribut des Alter(n)s, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181604