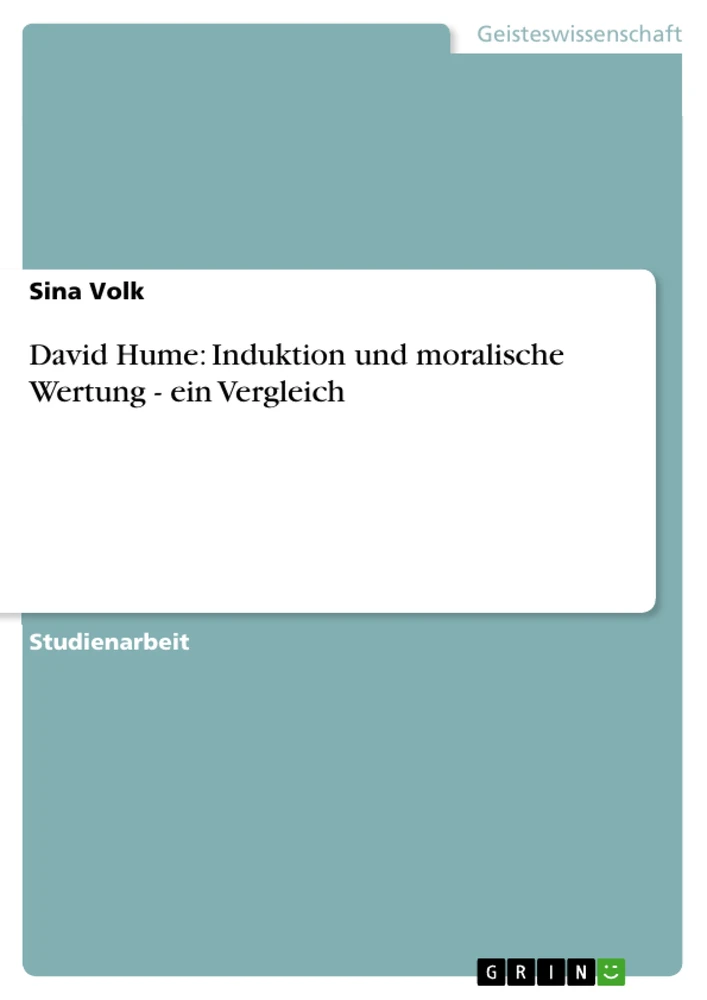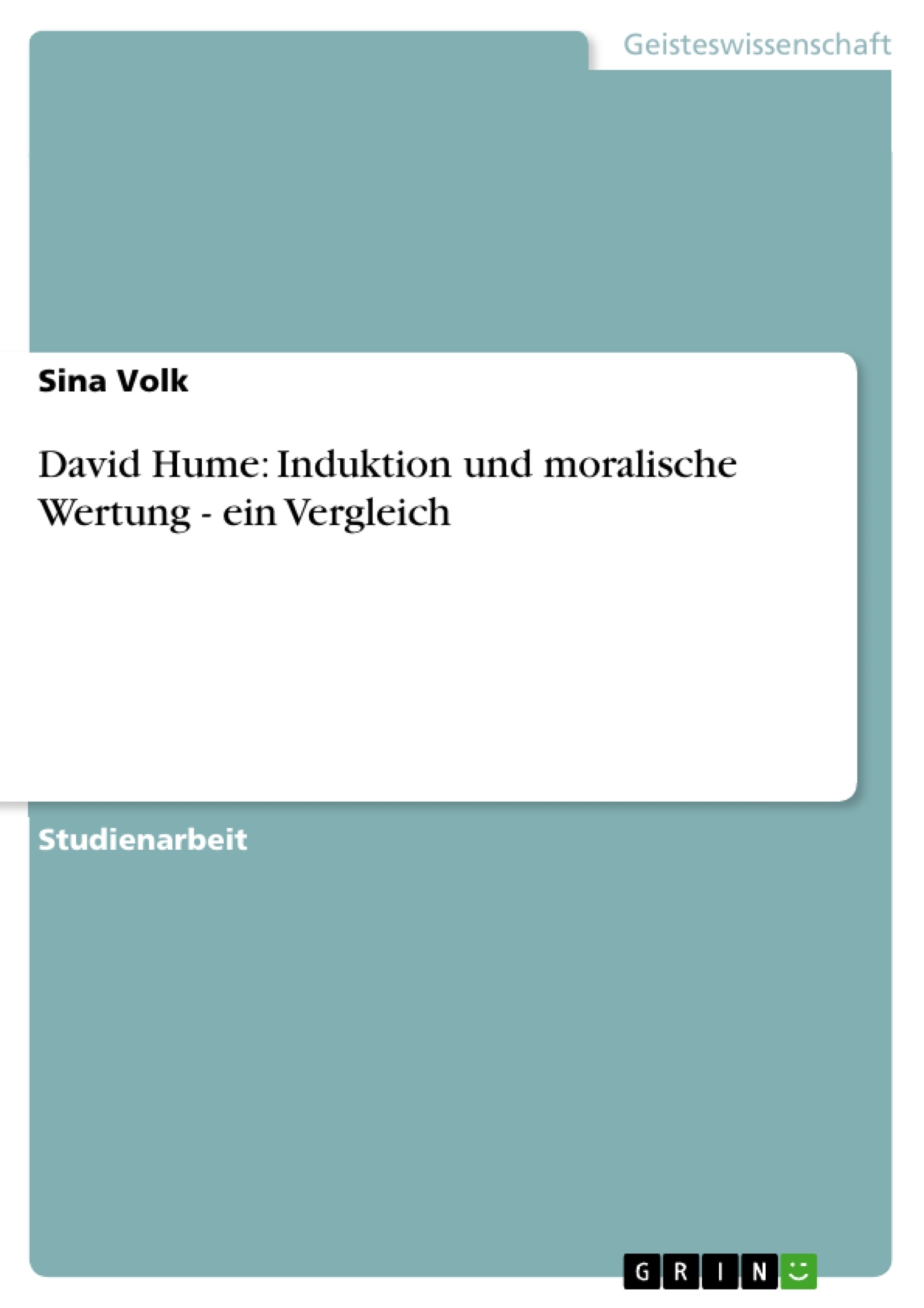I. Einleitung
David Hume (1711-1776) ist einer der bedeutendsten und meistrezipierten Denker der Neuzeit. Aufgrund seiner umfangreichen und vielseitigen Betrachtungen lässt er sich kaum kategorisieren: Er gilt als Empirist und Skeptiker mit Tendenzen zum Rationalismus und Naturalismus, hat historische Werke verfasst und sowohl die theoretische und praktische als auch die religiöse Philosophie sowie die Ökonomie maßgeblich beeinflusst. Er war einer der wenigen Philosophen, denen es vergönnt war, noch zu Lebzeiten Anerkennung und Ruhm für ihre Werke zu ernten.
Insbesondere seine Ausführungen zur Erkenntnistheorie und Moralphilosophie trafen weithin auf Resonanz: Hume erkannte mit als erster das Problem der induktiven Schlüsse für den Erkenntnisgewinn und wirkte mit seiner konsequentialistischen Moralphilosophie wegbereitend für den Utilitarismus. Daher sollen genau diese Aspekte von Humes Philosophie, seine Ansichten zum Induktionsproblem und zur moralischen Wertung, in der vorliegenden Arbeit in Form eines Vergleiches thematisiert werden. Zur Gewährleistung von Verständlichkeit und zur Hinführung erfolgt zunächst ein kurzer Überblick über die Grundzüge von Humes Philosophie, der sich grob an seinen Werken „Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand“ und „Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral“ orientiert. Daraufhin wird explizit auf die Begriffe der Induktion und der moralischen Wertung eingegangen, indem beide erklärt und miteinander verglichen werden. Dies führt zu einer kurzen Beleuchtung des Humeschen Gesetzes. Letztlich sollen kurz alternative Perspektiven zu Humes Ansicht aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Grundzüge der Philosophie David Humes
- III. Induktion und moralische Wertung
- 3.1. Begriffsklärung
- 3.2. Vergleich
- 3.3. Das Humesche Gesetz
- 3.4. Alternative Perspektiven
- 3.4.1. Immanuel Kant
- 3.3.2. Karl Popper
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Philosophie David Humes, insbesondere seine Ansichten zur Induktion und zur moralischen Wertung. Sie untersucht, wie Hume das Problem der induktiven Schlüsse in Bezug auf die Erkenntnisgewinnung und die Entstehung von Moralvorstellungen begreift.
- Humes Empirismus und die Rolle der Erfahrung in der Erkenntnis
- Das Problem der Induktion und die Unmöglichkeit, kausale Beziehungen vollständig zu begründen
- Humes Moralphilosophie und die naturgegebenen Moralvorstellungen des Menschen
- Die Bedeutung von Glück, Harmonie und sozialem Zusammenleben für Humes Moralverständnis
- Der Einfluss von Hume auf spätere philosophische Strömungen, wie den Utilitarismus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt David Hume als einen der bedeutendsten Denker der Neuzeit vor und hebt seine vielseitigen philosophischen Leistungen hervor. Sie führt das Thema der Arbeit – Induktion und moralische Wertung – ein und erläutert den Aufbau der Arbeit.
II. Grundzüge der Philosophie David Humes: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die zentralen Elemente von Humes Philosophie, einschließlich seines Empirismus, der Unterscheidung zwischen Eindrücken und Vorstellungen sowie der Kritik am a priori Wissen.
III. Induktion und moralische Wertung: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Induktion für Humes Erkenntnistheorie und seine Moralphilosophie. Es analysiert, wie Humes Kritik am Induktionsproblem die Frage nach der Begründbarkeit von Moralvorstellungen beeinflusst.
Schlüsselwörter
David Hume, Empirismus, Induktion, Moral, Kausalität, Gewohnheit, Erfahrung, Utilitarismus, Moralvorstellungen, Erkenntnistheorie, Naturgesetze, Vernunft, Glück, Harmonie, Soziales Wesen.
- Quote paper
- Sina Volk (Author), 2011, David Hume: Induktion und moralische Wertung - ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181605