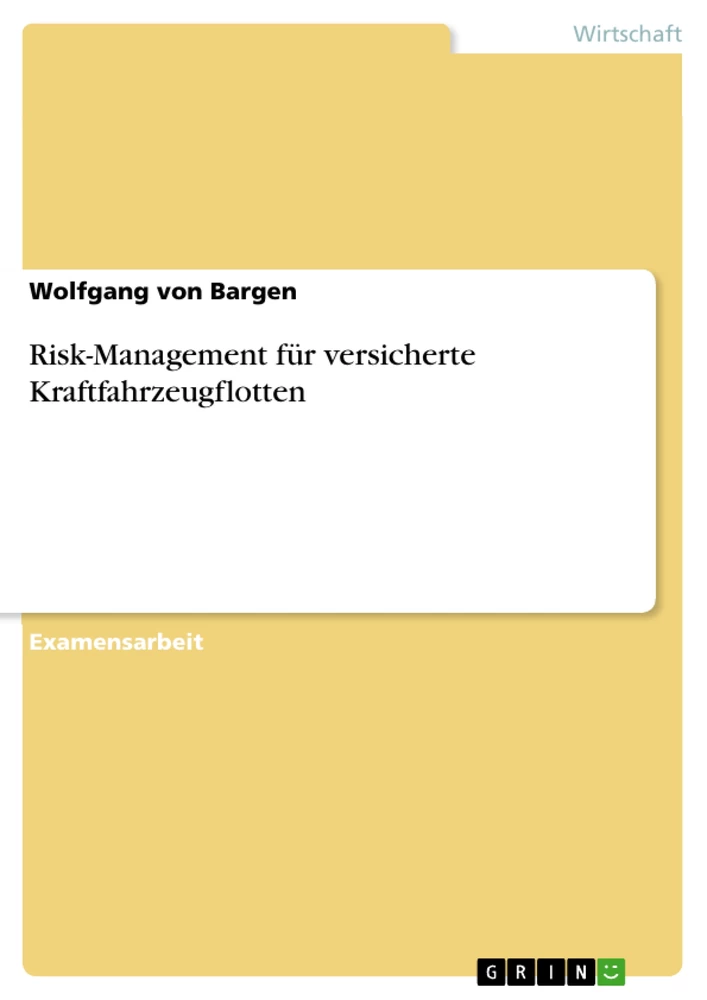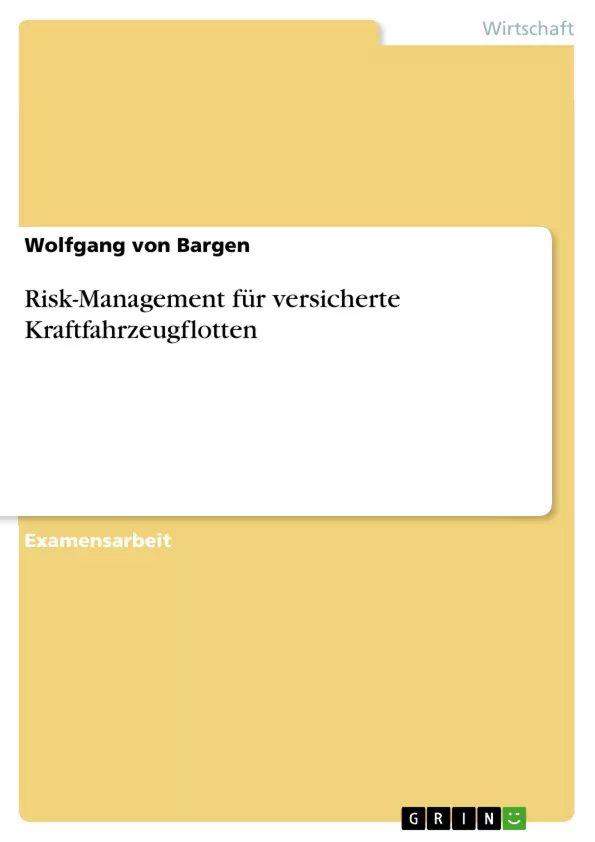Die Anzahl der in Deutschland zugelassen Kraftfahrzeuge steigt stetig. Ähnliches gilt für die Beförderungsleistung im Straßengüterverkehr, die von 1995 bis 2008 um 44 % angestiegen ist. Mehr Verkehrsteilnehmer bedeuten auch mehr potenzielle Gefahrenquellen, denn noch immer sind die meisten Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden auf menschliches Verhalten zurückzuführen. Demzufolge erhöht sich auch das Risiko für den Kraftfahrzeugflotteninhaber. Der Abschluss eines Kraftfahrzeugversicherungsvertrages deckt nicht alle Risiken; ein Teil des Risikos bleibt je nach Versicherungsumfang beim Unternehmer.
Untersuchungen der Gesellschaft für die Schadenverhütung im Verkehrsgewerbe (GSV) aus dem Jahre 1995 haben ergeben, dass trotz Versicherungsschutz z.B. bei einem Schaden mit einem motorisierten Nutzfahrzeug durchschnittlich Kosten pro Schaden von ca. € 2.200 bis € 2.900 vom Unternehmer zu tragen sind.
Diese Arbeit zeigt, welche Risiken trotz Versicherungsvertrag beim Unternehmer verbleiben, welche Maßnahmen er durch gezieltes Risk-Management zur Reduzierung seines Risikos – und damit auch seiner Kosten – einleiten kann und welche externe Unterstützung er hierbei erhält.
In Kapitel 2 wird zunächst die Problematik eines einheitlichen Risikobegriffes erörtert und die für diese Arbeit zugrundeliegende Definition dargestellt. Ferner wird aufgezeigt, dass der Abschluss einer Versicherung nicht gleichbedeutend mit einem Betriebsalltag ohne Risiko ist, sondern dass aus einem Verkehrsunfall oder einem anderen Schadenereignis sowohl direkte als auch indirekte Folgekosten für den Versicherungsnehmer entstehen können; auf das zu den Schadenereignisfolgekosten gehörende Reputationsrisiko und andere schwer in Geld zu beziffernde Folgen wird in einem Unterkapitel besonders eingegangen. Die Risikoanalyse, die die Basis für jegliche Handlungsalternativen im Risk-Management bildet, wird zusammen mit verschiedenen Identifikations- und Bewertungsinstrumenten vorgestellt. Anschließend gibt der Autor einen Überblick über die im Risk-Management für den versicherten Fuhrpark einsetzbaren risikopolitischen Instrumente.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlagen der Untersuchung, Gang der Arbeit, Abgrenzung
- 2. Das Risiko und die Aufgabe des Risk-Managements
- 2.1 Der Risikobegriff
- 2.2 Versicherbares und unversicherbares Risiko
- 2.2.1 Direkte Folgekosten durch das Schadenereignis
- 2.2.2 Indirekte Folgekosten durch das Schadenereignis
- 2.2.3 Das Reputationsrisiko und andere Begleitumstände
- 2.3 Die Risikoanalyse
- 2.4 Einsatz der risikopolitischen Instrumente
- 3. Kernrisiken bei Kraftfahrzeugflotten und die damit verbundenen Maßnahmenmöglichkeiten
- 3.1 Organisatorische Maßnahmen
- 3.2 Personelle Maßnahmen
- 3.3 Technische Maßnahmen
- 4. Externe Unterstützung beim betrieblichen Risk-Management
- 4.1 Risk-Management-Beratung als Dienstleistung der Assekuranzwirtschaft
- 4.2 Unfallforschung der Versicherungswirtschaftsverbände
- 4.3 Genossenschaften und Verbände des Verkehrsgewerbes und ihre Schadenverhütungsarbeit
- 4.4 Staatlich unterstützte Maßnahmen
- 5. Schlussfolgerung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Risiken, die trotz bestehender Kraftfahrzeugversicherung für Flotteninhaber verbleiben. Sie zeigt Maßnahmen zur Risikominderung und Kostenreduktion durch gezieltes Risk-Management auf und beleuchtet die verfügbare externe Unterstützung.
- Definition und Abgrenzung des Risikobegriffs im Kontext der Kraftfahrzeugflottenversicherung
- Analyse versicherbarer und unversicherbarer Risiken sowie deren Folgekosten (direkte und indirekte Kosten, Reputationsrisiko)
- Beschreibung von Maßnahmen zur Risikominderung (organisatorisch, personell, technisch)
- Vorstellung externer Unterstützungsmöglichkeiten durch Beratung, Verbände und staatliche Programme
- Überblick über risikopolitische Instrumente im Fuhrpark-Risk-Management
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt den Untersuchungsgegenstand. Kapitel 2 erörtert den Risikobegriff und unterscheidet zwischen versicherbaren und unversicherbaren Risiken, inklusive der Analyse von direkten und indirekten Folgekosten sowie des Reputationsrisikos. Es werden auch Instrumente der Risikoanalyse und risikopolitische Maßnahmen vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich mit Kernrisiken von Kraftfahrzeugflotten und möglichen Maßnahmen zur Risikominderung in den Bereichen Organisation, Personal und Technik. Kapitel 4 beschreibt die externe Unterstützung beim betrieblichen Risk-Management durch Versicherer, Verbände und staatliche Institutionen.
Schlüsselwörter
Risk-Management, Kraftfahrzeugflottenversicherung, Versicherbares Risiko, Unversicherbares Risiko, Folgekosten, Risikoanalyse, Risikominderung, Organisatorische Maßnahmen, Personelle Maßnahmen, Technische Maßnahmen, Externe Unterstützung, Schadenverhütung.
- Arbeit zitieren
- Wolfgang von Bargen (Autor:in), 2010, Risk-Management für versicherte Kraftfahrzeugflotten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181630