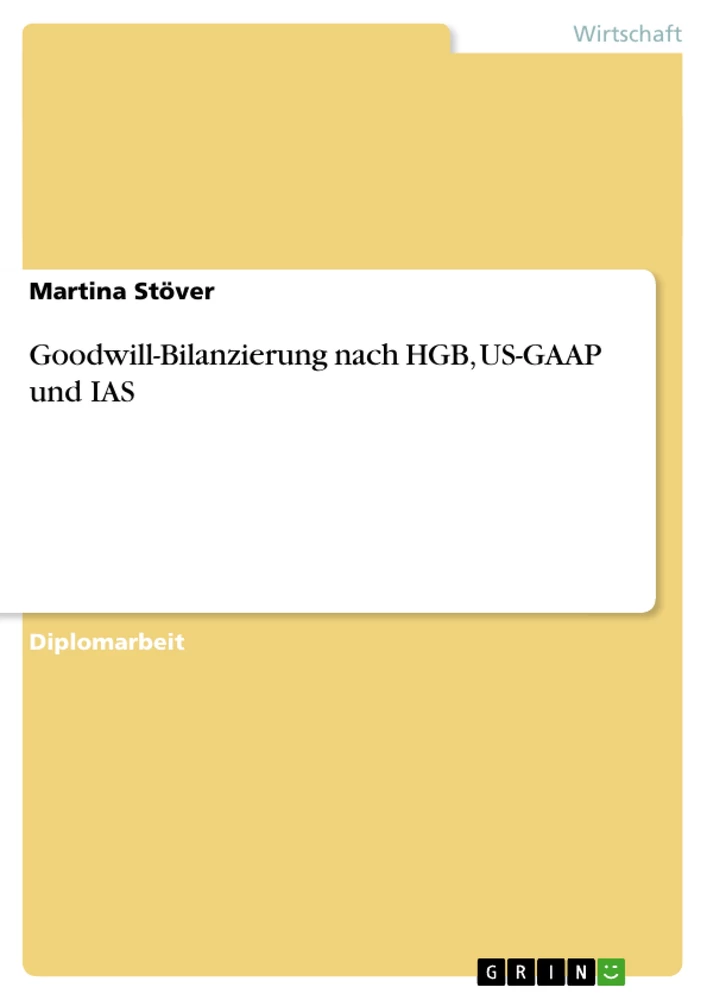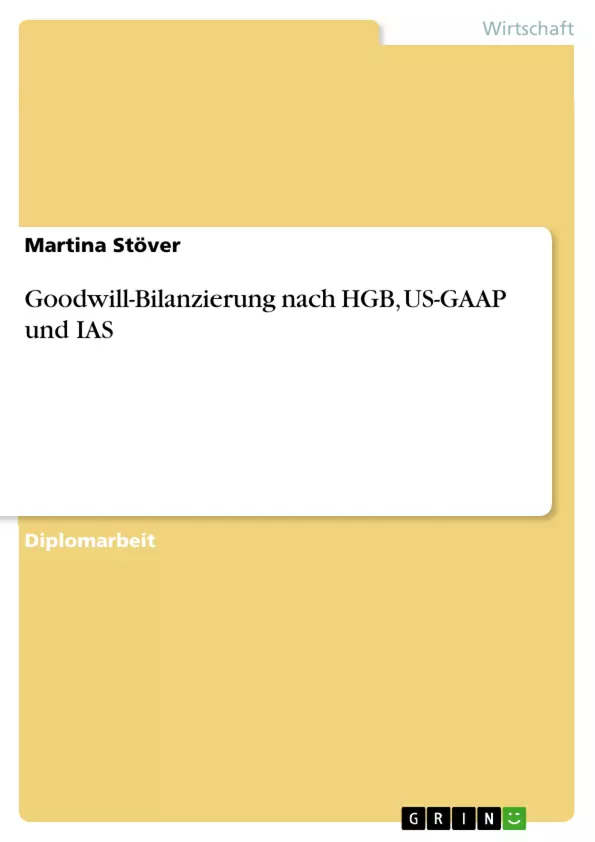[...] In vielen Bilanzen nimmt der Geschäfts- oder
Firmenwert mehr als die Hälfte der Bilanzsumme ein und erreicht nicht selten die
Höhe des bilanziellen Eigenkapitals.1
Aufgrund dieser zentralen Bedeutung können schon geringe Änderungen in der Goodwill-
Bilanzierung zu weitreichenden Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögensund
Ertragslage führen und z.B. ansonsten wünschenswerte Unternehmenszusammenschlüsse
begünstigen oder verhindern. Nachdem das FASB im Juni 2001 die für die Bilanzierung
des Goodwills entscheidenden neuen US-amerikanischen Standards SFAS
141 „Business Combinations“ und SFAS 142 „Goodwill and Other Intangible Assets“
verabschiedet hat, hat das IASB im Rahmen der ersten Phase des eigenen Projektes
„Business Combinations“ am 5.12.2002 den Exposure Draft (ED) 3 „Business Combinations“
veröffentlicht, der IAS 22 (revised 1998) ersetzen soll. Dem ED 3 liegt u.a. die
Zielsetzung des IASB zugrunde, eine Annäherung der internationalen Rechnungslegungsvorschriften
herbeizuführen. Wesentliche Änderungen ergeben sich dadurch für
die Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten und die Durchführung von Impairment
Tests für den Goodwill. Die Fassungen dieser betreffenden IAS-Standards IAS
36 „Impairment of Assets“ und IAS 38 „Intangible Assets“ wurden überarbeitet und ebenfalls
als Entwürfe ED-IAS 36 und ED-IAS 38 veröffentlicht.2 Die Veröffentlichung des
endgültigen International Financial Reporting Standards (IFRS) ist für März 2004 geplant.
3
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, den Ansatz, die Behandlung und den
Ausweis des aus der Kapitalkonsolidierung resultierenden Geschäfts- oder Firmenwertes
nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB), nach den United States Generally
Accepted Accounting Principles (US-GAAP) und nach den International Accounting
Standards (IAS) zu untersuchen. Einleitend wird dabei auf den Begriff, die Komponenten
und die Bedeutung des Goodwills eingegangen. Im Folgenden werden die Regelungen
in den drei Rechtskreisen getrennt voneinander analysiert und im Anschluss an einen
Gesamtrechtsvergleich einer kritischen Würdigung unterzogen. Den Schwerpunkt
der Arbeit bildet die außerplanmäßige Abschreibung (Wertminderung) des Geschäftsoder
Firmenwertes. Die Auswirkungen der Neuregelungen beschließen die Diskussion.
1 Vgl. Kümpel, T.: Goodwillbilanzierung nach SFAS 142, 2002, S. 15.
2 Vgl. DRSC (Hrsg.): ED 3 Veröffentlichung, o.J.
3 Vgl. Pellens, B.: Juni-Sitzung des IASB, 2003.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gegenstand und Bedeutung des Geschäfts- oder Firmenwertes
- 2.1 Begriff
- 2.2 Komponenten
- 2.3 Bedeutung
- 3. Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach HGB
- 3.1 Bilanzieller Charakter
- 3.2 Entstehung und Ansatz
- 3.3 Folgebilanzierung
- 3.3.1 Pauschale Abschreibung
- 3.3.2 Planmäßige Abschreibung
- 3.3.3 Außerplanmäßige Abschreibung
- 3.4 Verrechnung mit den Rücklagen
- 3.5 Bedeutung des Stetigkeitsgebotes
- 3.6 Ausweis und Anhangpflichten
- 4. Bilanzierung nach DRS 4
- 4.1 Erstansatz
- 4.2 Folgebewertung
- 4.3 Anhangangaben
- 5. Bilanzierung des Goodwills nach US-GAAP
- 5.1 Bilanzieller Charakter
- 5.2 Entstehung und Abgrenzung
- 5.3 Folgebewertung
- 5.3.1 Zuordnung des Goodwills auf Reporting Units
- 5.3.2 Impairment -Test
- 5.4 Ausweis und Offenlegung
- 6. Bilanzierung des Goodwills nach IAS
- 6.1 Bilanzieller Charakter
- 6.2 Entstehung und Abgrenzung
- 6.3 Folgebewertung nach IAS 22
- 6.3.1 Planmäßige Abschreibung
- 6.3.2 Außerplanmäßige Abschreibung
- 6.4 Folgebewertung nach IAS ED 3
- 6.5 Ausweis und Anhangangaben
- 7. Gesamtrechtsvergleich
- 7.1 Zusammenfassung der Unterschiede
- 7.2 Minderheitenproblematik
- 8. Kritische Würdigung
- 9. Auswirkungen der Neuregelungen
- 9.1 Finanz- und Ertragslage
- 9.2 Controlling
- 9.3 Wirtschaftsprüfer
- 9.4 Einklang mit den EU-Richtlinien
- 10. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Goodwill-Bilanzierung nach verschiedenen Rechnungslegungsstandards (HGB, US-GAAP und IAS). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Bilanzierungsmethoden aufzuzeigen und kritisch zu würdigen. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der unterschiedlichen Regelungen auf die Finanz- und Ertragslage von Unternehmen.
- Vergleich der Goodwill-Bilanzierung nach HGB, US-GAAP und IAS
- Analyse der Unterschiede in Entstehung, Ansatz und Folgebewertung von Goodwill
- Bewertung der Auswirkungen der verschiedenen Bilanzierungsmethoden auf die Unternehmensberichterstattung
- Kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Vorschriften und deren Auswirkungen
- Minderheitenproblematik im Kontext des internationalen Vergleichs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt den Hintergrund und die Relevanz der Goodwill-Bilanzierung im Kontext verschiedener Rechnungslegungsstandards. Sie skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
2. Gegenstand und Bedeutung des Geschäfts- oder Firmenwertes: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Geschäfts- oder Firmenwertes (Goodwill), beschreibt seine Komponenten und erläutert seine Bedeutung für die Unternehmensbewertung und -berichterstattung. Es legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es den zentralen Gegenstand der Arbeit präzisiert.
3. Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach HGB: Dieses Kapitel analysiert die Bilanzierung des Geschäftswertes nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Es beleuchtet den bilanziellen Charakter, die Entstehung und den Ansatz von Goodwill sowie die verschiedenen Methoden der Folgebilanzierung (pauschal, planmäßig, außerplanmäßig). Die Bedeutung des Stetigkeitsgebotes und die Ausweis- und Anhangpflichten werden ebenfalls behandelt. Der Fokus liegt auf der Darstellung des deutschen rechtlichen Rahmens und der damit verbundenen Herausforderungen.
4. Bilanzierung nach DRS 4: Hier wird die Bilanzierung des Goodwills nach dem Deutschen Rechnungslegungsstandard (DRS) 4 behandelt. Der Fokus liegt auf dem Erstansatz, der Folgebewertung und den notwendigen Anhangangaben. Der Vergleich mit dem HGB wird implizit vorgenommen, indem Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit Goodwill hervorgehoben werden. Die Kapitel beleuchtet die Weiterentwicklung der deutschen Rechnungslegung im Kontext internationaler Standards.
5. Bilanzierung des Goodwills nach US-GAAP: Dieses Kapitel beschreibt die Bilanzierung von Goodwill nach den US Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP). Es analysiert den bilanziellen Charakter, die Entstehung und Abgrenzung von Goodwill, die Folgebewertung inklusive des Impairment-Tests und die Ausweis- und Offenlegungspflichten. Der Schwerpunkt liegt auf den Besonderheiten des US-amerikanischen Systems im Vergleich zu den deutschen Regelungen.
6. Bilanzierung des Goodwills nach IAS: Dieses Kapitel behandelt die Bilanzierung von Goodwill nach den International Accounting Standards (IAS). Es beleuchtet den bilanziellen Charakter, die Entstehung und Abgrenzung von Goodwill sowie die verschiedenen Methoden der Folgebewertung nach IAS 22 und IAS ED 3. Die Ausweis- und Anhangangaben werden ebenfalls diskutiert. Der Vergleich mit den vorherigen Kapiteln, insbesondere die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Umgang mit Goodwill, bilden den Kern dieses Kapitels.
7. Gesamtrechtsvergleich: Dieses Kapitel fasst die Unterschiede in der Goodwill-Bilanzierung nach HGB, US-GAAP und IAS zusammen und analysiert die Minderheitenproblematik im Kontext des internationalen Vergleichs. Es bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Ansätze und deren Konsequenzen.
8. Kritische Würdigung: Dieses Kapitel bietet eine kritische Würdigung der verschiedenen Goodwill-Bilanzierungsmethoden und deren Auswirkungen. Es analysiert Stärken und Schwächen der einzelnen Systeme und diskutiert deren Implikationen für die Praxis.
9. Auswirkungen der Neuregelungen: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der verschiedenen Goodwill-Bilanzierungsmethoden auf die Finanz- und Ertragslage von Unternehmen, das Controlling und die Arbeit der Wirtschaftsprüfer. Der Einklang mit den EU-Richtlinien wird ebenfalls analysiert. Es wird der praktische Einfluss der unterschiedlichen Regelungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Goodwill, Bilanzierung, HGB, US-GAAP, IAS, Folgebewertung, Impairment-Test, Rechnungslegung, Unternehmensbewertung, Abschreibung, Minderheitenproblematik, EU-Richtlinien, DRS 4, Reporting Units.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Goodwill-Bilanzierung nach HGB, US-GAAP und IAS
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Bilanzierung von Goodwill nach drei verschiedenen Rechnungslegungsstandards: dem Handelsgesetzbuch (HGB), den US Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) und den International Accounting Standards (IAS). Im Mittelpunkt steht der Vergleich der Methoden, die Analyse ihrer Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie eine kritische Würdigung ihrer Auswirkungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung, den Ansatz und die Folgebewertung von Goodwill unter den drei genannten Standards. Es werden die jeweiligen bilanziellen Charakteristika, die Methoden der Abschreibung (pauschal, planmäßig, außerplanmäßig), der Impairment-Test (US-GAAP), die Anhangangaben und die Minderheitenproblematik im internationalen Vergleich beleuchtet. Zusätzlich werden die Auswirkungen der unterschiedlichen Regelungen auf die Finanz- und Ertragslage von Unternehmen, das Controlling und die Wirtschaftsprüfung untersucht.
Welche Standards werden verglichen?
Die Diplomarbeit vergleicht die Goodwill-Bilanzierung nach HGB, US-GAAP und IAS. Der Vergleich umfasst die Analyse der jeweiligen Vorschriften und deren Auswirkungen auf die Unternehmensberichterstattung. Dabei wird auch der Deutsche Rechnungslegungsstandard (DRS) 4 berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zehn Kapitel gegliedert: Einleitung, Gegenstand und Bedeutung des Geschäfts- oder Firmenwertes, Bilanzierung nach HGB, Bilanzierung nach DRS 4, Bilanzierung nach US-GAAP, Bilanzierung nach IAS, Gesamtrechtsvergleich, Kritische Würdigung, Auswirkungen der Neuregelungen und Resümee. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Goodwill-Bilanzierung.
Welche Methoden der Folgebewertung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Methoden der Folgebewertung von Goodwill, darunter die pauschale, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibung (HGB), die Folgebewertung nach IAS 22 und IAS ED 3 sowie den Impairment-Test (US-GAAP).
Welche Bedeutung hat der Impairment-Test?
Der Impairment-Test spielt im US-GAAP eine zentrale Rolle bei der Folgebewertung von Goodwill. Er dient der Überprüfung der Wertminderung und ist ein wichtiger Bestandteil des Vergleichs der Bilanzierungsmethoden.
Wie wird die Minderheitenproblematik behandelt?
Die Minderheitenproblematik wird im Kapitel zum Gesamtrechtsvergleich im Kontext des internationalen Vergleichs der Goodwill-Bilanzierung analysiert.
Welche Auswirkungen auf die Unternehmensberichterstattung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der unterschiedlichen Goodwill-Bilanzierungsmethoden auf die Finanz- und Ertragslage von Unternehmen, das Controlling, die Arbeit der Wirtschaftsprüfer und den Einklang mit den EU-Richtlinien.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Goodwill, Bilanzierung, HGB, US-GAAP, IAS, Folgebewertung, Impairment-Test, Rechnungslegung, Unternehmensbewertung, Abschreibung, Minderheitenproblematik, EU-Richtlinien, DRS 4, Reporting Units.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständigen Details und Analysen finden sich in der vollständigen Diplomarbeit.
- Arbeit zitieren
- Martina Stöver (Autor:in), 2003, Goodwill-Bilanzierung nach HGB, US-GAAP und IAS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18164