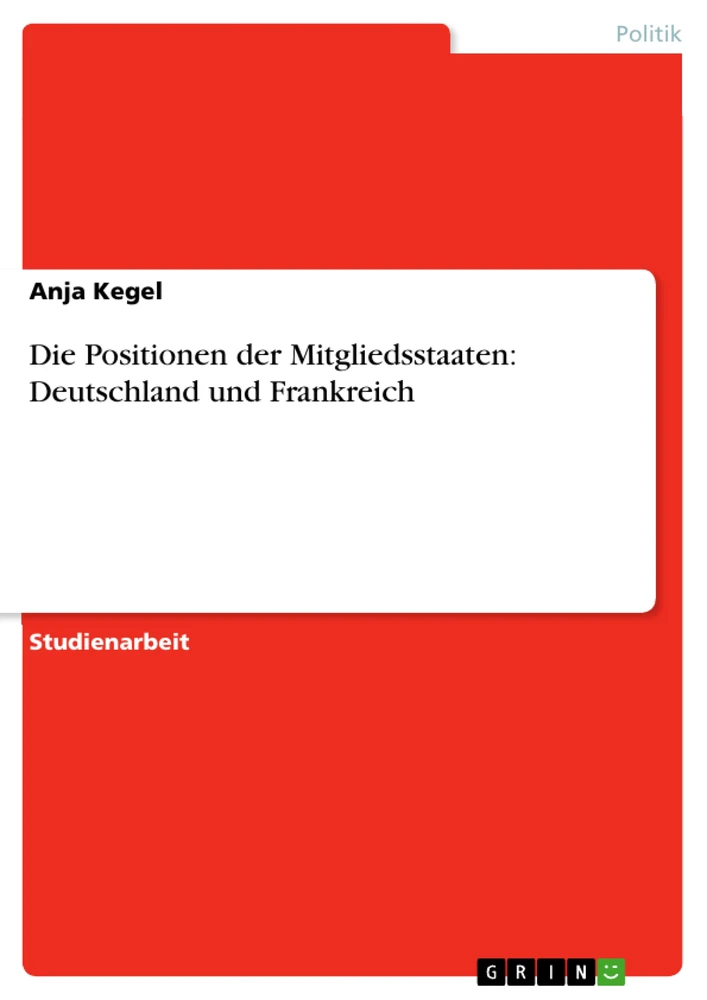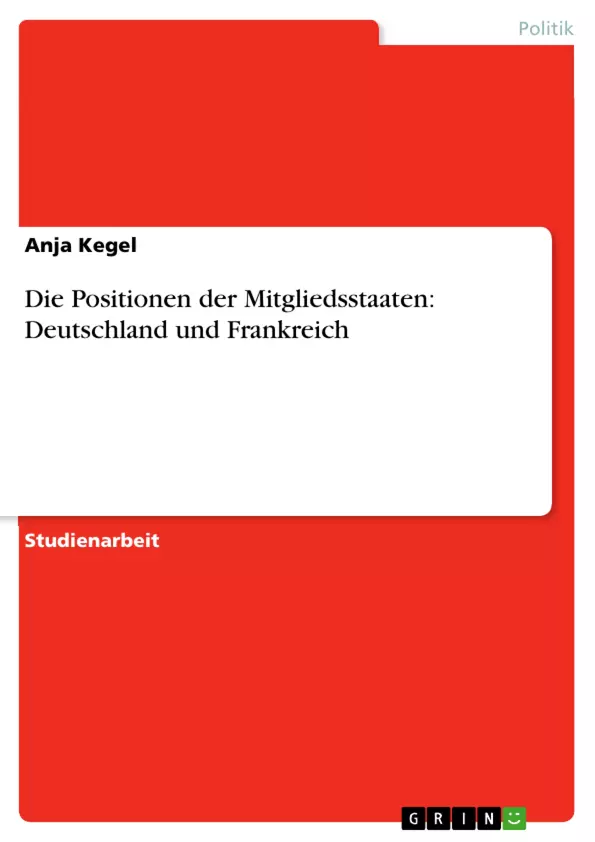Die Eurokrise ausgelöst von der Griechenlandkrise hatte und hat weitreichende Folgen
für alle europäischen Mitgliedsstaaten. Nun steht Europa vor der Herausforderung, etwas
Grundlegendes zu ändern und die Schwachstellen der EU auszubessern. Es ist notwendig,
sich mit der Frage nach europäischer Solidarität auseinanderzusetzten und zu
klären, inwieweit diese in der EU stattfinden soll.
Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Solidarität? Bei dem Terminus Solidarität
handelt es sich um ein Prinzip, welches auf Zusammengehörigkeit beruht, d.h. die gegenseitige
Verantwortung und Verpflichtung. Man kann auf Basis einer gemeinsamen
politischen Überzeugung, einer wirtschaftlichen oder sozialen Lage solidarisch handeln.
Solidarisch Handeln meint, man hilft dem anderen aus der Gemeinschaft und drückt auf
diese Weise die eigene Solidarität für ihn aus. Europäische Solidarität beruht nach Böckenförde
ebenso auf einem gewissen Maß an Gemeinsamkeit, d.h. es sollte ein gemeinsames
Wir-Gefühl bzw. eine gemeinsame Identität vorhanden sein, denn nur auf
diese Weise kann er auch zur Anerkennung gemeinsamer Verantwortung, Einstandspflichten
und wechselseitiger Leistungsbereitschaft kommen. Wie steht es um die Solidarität
in Europa und welche Rolle spielen hierbei die beiden Mitgliedsstaaten Deutschland
und Frankreich? Beide Länder verfolgen unterschiedliche europäische Politikkonzepte,
aber wie können diese miteinander verknüpft werden. Können beide Länder eine
wegweisende Rolle in der EU übernehmen?
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich einerseits mit der Krise in Europa und andererseits
mit den Positionen der Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich. Ferner geht es
darum, darzustellen, wie es mit der Europäischen Union weitergehen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau der Hausarbeit
- Begriffsdefinition der Kernbegriffe
- Der Begriff Krise
- Das moderne Verständnis von Solidarität
- Die Krise in Europa
- Wie kam es zur Krise – was war der Auslöser?
- Die Griechenlandkrise
- Ist die Krise überstanden? Was sind die Folgen der Europakrise?
- Die Positionen der Mitgliedstaaten
- Deutschland und seine Rolle in der EU
- Die französische Position
- Wo liegen die Unterschiede – wo gibt es Kompromissmöglichkeiten?
- Wie könnte es mit der Europäischen Union weitergehen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Eurokrise und den damit verbundenen Herausforderungen für die europäische Solidarität. Sie analysiert die Positionen von Deutschland und Frankreich in Bezug auf die Krise und die möglichen Wege, die die Europäische Union in Zukunft einschlagen könnte.
- Analyse der Eurokrise und ihrer Ursachen
- Untersuchung des Begriffs der Solidarität im Kontext der EU
- Vergleich der deutschen und französischen Positionen zur europäischen Politik
- Bewertung der Auswirkungen der Krise auf die Mitgliedsstaaten
- Sichtung von möglichen Lösungsansätzen für die Europäische Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Hausarbeit vor und führt den Leser in die Thematik der Eurokrise und der europäischen Solidarität ein. Das zweite Kapitel definiert die Kernbegriffe „Krise“ und „Solidarität“ und erläutert deren Bedeutung im Kontext der europäischen Integration. Das dritte Kapitel analysiert die Ursachen und Folgen der Eurokrise, wobei die Griechenlandkrise als ein zentrales Beispiel betrachtet wird. Im vierten Kapitel werden die Positionen von Deutschland und Frankreich in Bezug auf die Eurokrise und die europäische Solidarität beleuchtet. Das fünfte Kapitel diskutiert mögliche Szenarien für die Zukunft der Europäischen Union.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind Eurokrise, Solidarität, Deutschland, Frankreich, Europäische Union, Griechenland, Krisenmanagement, Integration, Politikkonzepte, Kompromisse, Zukunftsszenarien.
- Quote paper
- B.A. Politik und Verwaltung, Soziologie Anja Kegel (Author), 2011, Die Positionen der Mitgliedsstaaten: Deutschland und Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181677