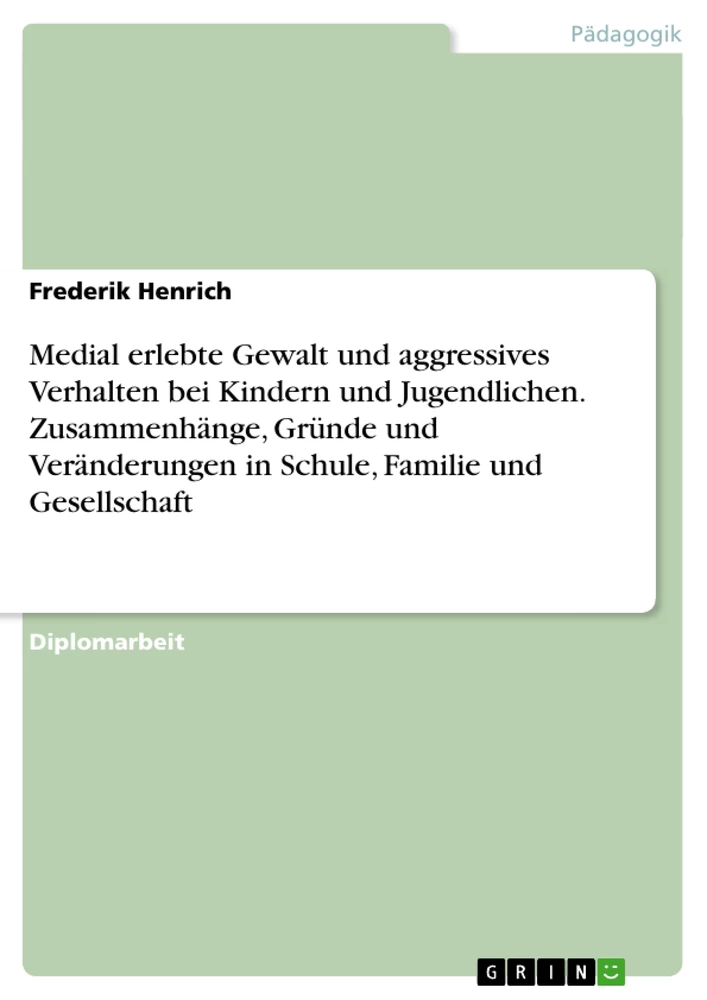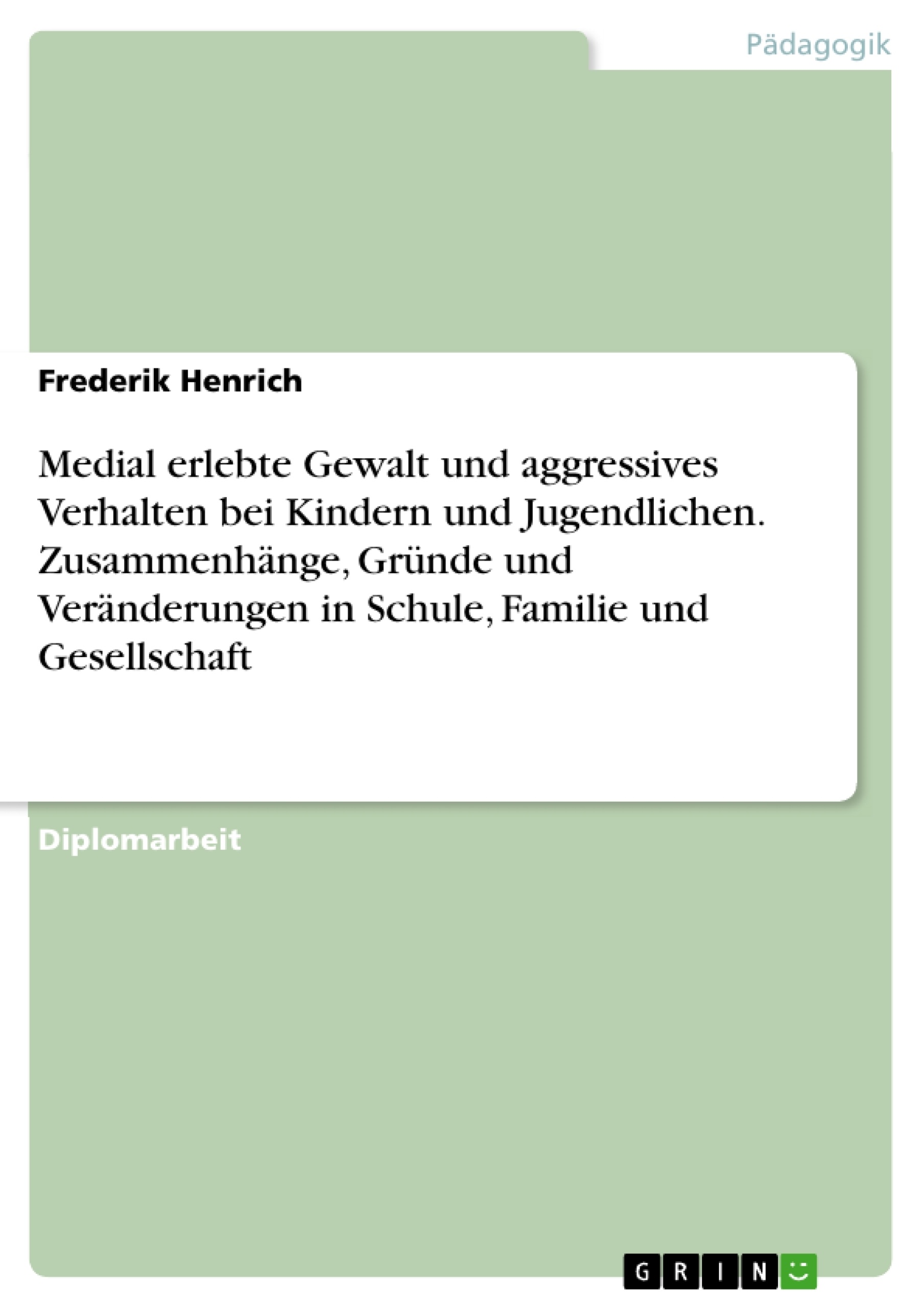Am Morgen des 26. April 2002 tötete der 19jährige ehemalige Schüler Robert Steinhäuser während der Abiturprüfungen im Erfurter Gutenberg Gymnasium 17 Menschen, darunter 12 Lehrer, zwei Mitschüler, die Schulsekretärin, einen Polizisten und
erschoss schließlich sich selbst. Ganz Deutschland trauerte mit den Hinterbliebenen der Opfer dieses dramatischen Amoklaufes und die Frage nach dem ,Warum’ beschäftigte wochenlang die Schlagzeilen der Gazetten.
Auf der Suche nach Gründen für diese schreckliche Tat wurden viele schnell fündig. Roberts exzessiver Konsum von Gewalt- und Horrorvideos zusammen mit seiner Leidenschaft für brutale Video- und Computerspiele sollten Ursache, Motivation und Vorbild für diese Tragödie sein. Für viele Eltern, Lehrer, Politiker und vor allem die Medien selbst war das ein naheliegender Zusammenhang, um das furchtbare Geschehen überhaupt erklären zu können.
Gewalt in den Medien und besonders die Gewaltdarstellungen in Film und Fernsehen sowie brutale Video- und Computerspiele rücken nicht zum ersten Mal ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Zum wiederholten Male werden deren schädigende Einflüsse
und Wirkungspotentiale auf Kinder und Jugendliche fester Bestandteil der öffentlichen Diskussion. Doch auch Gegenstimmen sind zu hören, die auf andere Determinanten wie familiäre Situation, schulische Probleme und gesellschaftliche Zwänge
als grundlegende Faktoren hinweisen, welche Gewaltbereitschaft in der Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen verankern.
Aufgrund der Ereignisse von Erfurt und der anschließenden Ambivalenz in der öffentlichen Diskussion um die Wirkung von Gewalt in den Medien entschloss ich mich, im Rahmen meiner Diplomarbeit nach Zusammenhängen zwischen medial erlebter
Gewalt und aggressivem Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu suchen. Dabei habe ich mich hauptsächlich auf mögliche Gewaltwirkungen von Film und Fernsehen und im zweiten Teil auf Computer- und Videospiele als relativ neue und im Vergleich
zum Fernsehen differenzierte Medien des Gewalterlebens konzentriert. Eine solche Trennung scheint mir angebracht, da trotz vieler Gemeinsamkeiten sich die Medien Fernsehen einerseits und Computer- / Videospiel andererseits in Hinsicht auf Verbreitung, Zielgruppen, Entwicklung, historischem Hintergrund und der Art des
Erlebens in wesentlichen Punkten voneinander unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zur Bestimmung des Gewaltbegriffs
- 2.1 Aggression und Aggressionstheorien
- 2.1.1 Aggression als Ausdruck eines Triebes
- 2.1.2 Die Frustrations-Aggressions-Theorie
- 2.1.3 Die Lerntheorie
- 2.2 Gewalt
- 2.2.1 Personale und strukturelle Gewalt
- 2.2.2 Physische, psychische und andere Formen von Gewalt
- 2.3 Mediale Gewalt
- 2.3.1 Definitionen medialer Gewalt in Film und Fernsehen
- 2.3.2 Medienspezifische Umgangsweisen mit Gewalt
- 2.3.3 Besonderheiten der symbolischen Gewalt
- 2.1 Aggression und Aggressionstheorien
- 3 Mediengewalt in der öffentlichen Diskussion
- 3.1 Die historische Diskussion um Mediengewalt
- 3.1.1 Von der Antike bis zum 19. Jahrhundert
- 3.1.2 Der Gewaltdiskurs im 20. Jahrhundert
- 3.1.3 Besonderheiten des historischen Gewaltdiskurses
- 3.2 Der aktuelle Gewaltdiskurs
- 3.2.1 Beispiele zur gegenwärtigen Diskussion um Mediengewalt seit 1990
- 3.2.2 Die Rolle der Printmedien
- 3.2.3 Die gesellschaftliche Funktion der Diskussion
- 3.3 Merkmale des öffentlichen Gewaltdiskurses
- 3.3.1 Die Folge eines öffentlichen Selbstverständnisses
- 3.3.2 Die Wahrnehmungskluft in der Medienrezeption
- 3.3.3 Wissenschaft und Öffentlichkeit
- 3.1 Die historische Diskussion um Mediengewalt
- 4 Die wissenschaftliche Untersuchung der Mediengewalt in Film und Fernsehen
- 4.1 Inhaltsanalysen
- 4.1.1 Allgemeine Probleme der inhaltsanalytischen Untersuchungen
- 4.1.2 Ausgewählte Inhaltsanalysen
- 4.1.3 Die Bedeutung inhaltsanalytischer Erkenntnisse
- 4.2 Untersuchungen zur Wirkung von Mediengewalt
- 5 Mediale Gewalt in Video- und Computerspielen
- 5.1 Computerspiele in öffentlicher Kritik
- 5.2 Besonderheiten des Computer- und Videospielens
- 5.2.1 Computerspielgewalt – Reale Gewalt – Filmgewalt
- 5.2.2 Die Faszinationskraft virtueller Gewalt
- 5.2.3 „Doom“ und die Ego-Shooter – Gewalt im Spiel
- 5.3 Zur Wirkung der Computergewalt
- 5.3.1 Wirkungsannahmen
- 5.3.2 Was weiß die Wissenschaft?
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen medial erlebter Gewalt und aggressivem Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen von Film, Fernsehen und, im zweiten Teil, auf Computer- und Videospielen. Die Arbeit analysiert die öffentliche Diskussion um Mediengewalt und beleuchtet verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Erforschung der Wirkung von medialer Gewalt.
- Der Einfluss von Mediengewalt auf das aggressive Verhalten von Kindern und Jugendlichen
- Analyse der öffentlichen Debatte über Mediengewalt und deren historische Entwicklung
- Wissenschaftliche Theorien und Studien zur Wirkung von Mediengewalt (z.B. Katharsisthese, Stimulationsthese)
- Vergleich der Wirkung von Gewalt in Film/Fernsehen und in Computer-/Videospielen
- Untersuchung der Besonderheiten von Computer- und Videospielen im Kontext von Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit dem Amoklauf von Erfurt und der darauf folgenden öffentlichen Debatte über die Rolle von Mediengewalt. Sie führt in das Thema ein und begründet die Relevanz der Arbeit, indem sie die Ambivalenz der öffentlichen Diskussion und den Bedarf nach einer wissenschaftlichen Untersuchung herausstellt. Die Arbeit fokussiert auf die Wirkung von Gewalt in Film, Fernsehen und Computer-/Videospielen und betont die Unterschiede zwischen diesen Medien.
2 Zur Bestimmung des Gewaltbegriffs: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Aggression" und "Gewalt", indem es verschiedene Aggressionstheorien (Triebtheorie, Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorie) vorstellt und unterschiedliche Formen von Gewalt (personale, strukturelle, physische, psychische) unterscheidet. Es legt den Schwerpunkt auf die Definition von medialer Gewalt und deren spezifischen Charakteristika im Vergleich zu anderen Gewaltformen. Die verschiedenen Unterkapitel bieten einen umfassenden Überblick über den theoretischen Rahmen der Arbeit.
3 Mediengewalt in der öffentlichen Diskussion: Dieses Kapitel analysiert die öffentliche Diskussion um Mediengewalt historisch und aktuell. Es untersucht die Entwicklung des Gewaltdiskurses von der Antike bis in die Gegenwart, beleuchtet die Rolle der Printmedien in der aktuellen Debatte und analysiert die gesellschaftliche Funktion dieser Diskussion, einschließlich der Kluft zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und öffentlicher Wahrnehmung.
4 Die wissenschaftliche Untersuchung der Mediengewalt in Film und Fernsehen: Dieses Kapitel widmet sich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Mediengewalt. Es präsentiert verschiedene Forschungsmethoden (Inhaltsanalysen) und beleuchtet zentrale Theorien zur Wirkung von Mediengewalt, wie die Katharsisthese, Stimulationsthese, Habitualisierungsthese, Kultivierungsthese und Suggestionsthese. Der Kapitel fasst relevante Studien zusammen und bewertet die verschiedenen Wirkungsansätze.
5 Mediale Gewalt in Video- und Computerspielen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Besonderheiten der medialen Gewaltdarstellung in Computer- und Videospielen und deren Rezeption in der Öffentlichkeit. Es vergleicht die Gewaltdarstellung in diesen Medien mit der in Film und Fernsehen, analysiert die Faszination virtueller Gewalt und präsentiert ausgewählte Studien zur Wirkung von Computerspielgewalt. Die Zusammenfassung der Studienergebnisse bildet einen wichtigen Teil des Kapitels.
Schlüsselwörter
Mediengewalt, Aggression, Gewaltforschung, Filmgewalt, Fernsehgewalt, Computerspielgewalt, Videospielgewalt, Wirkungsforschung, Inhaltsanalyse, Katharsisthese, Stimulationsthese, Lerntheorie, öffentliche Diskussion, Jugendgewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Mediengewalt in Film, Fernsehen und Computerspielen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen medial erlebter Gewalt (in Film, Fernsehen und Computerspielen) und aggressivem Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert die öffentliche Diskussion um Mediengewalt und beleuchtet verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Erforschung der Wirkung von medialer Gewalt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Einfluss von Mediengewalt auf aggressives Verhalten, die Analyse der öffentlichen Debatte über Mediengewalt (historisch und aktuell), wissenschaftliche Theorien und Studien zur Wirkung von Mediengewalt (z.B. Katharsisthese, Stimulationsthese), den Vergleich der Wirkung von Gewalt in Film/Fernsehen und Computerspielen sowie die Untersuchung der Besonderheiten von Computer- und Videospielen im Kontext von Gewalt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Gewalt und Aggression, ein Kapitel zur öffentlichen Diskussion um Mediengewalt, ein Kapitel zur wissenschaftlichen Untersuchung von Mediengewalt in Film und Fernsehen, ein Kapitel zu medialer Gewalt in Video- und Computerspielen und abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Aggressionstheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aggressionstheorien, darunter die Triebtheorie, die Frustrations-Aggressions-Theorie und die Lerntheorie, um den Begriff der Aggression umfassend zu definieren und im Kontext von Mediengewalt einzuordnen.
Welche Arten von Gewalt werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von Gewalt, darunter personale und strukturelle Gewalt sowie physische und psychische Gewalt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Definition und den Besonderheiten von medialer Gewalt.
Wie wird die öffentliche Diskussion um Mediengewalt analysiert?
Die öffentliche Diskussion wird sowohl historisch (von der Antike bis zur Gegenwart) als auch aktuell analysiert. Die Rolle der Printmedien in der aktuellen Debatte und die gesellschaftliche Funktion dieser Diskussion, einschließlich der Kluft zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und öffentlicher Wahrnehmung, werden untersucht.
Welche wissenschaftlichen Methoden werden zur Untersuchung von Mediengewalt verwendet?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Forschungsmethoden, insbesondere Inhaltsanalysen, und beleuchtet zentrale Theorien zur Wirkung von Mediengewalt wie die Katharsisthese, Stimulationsthese, Habitualisierungsthese, Kultivierungsthese und Suggestionsthese. Relevante Studien werden zusammengefasst und die verschiedenen Wirkungsansätze bewertet.
Wie werden Computerspiele im Kontext von Gewalt betrachtet?
Das Kapitel zu Computerspielen vergleicht die Gewaltdarstellung in diesen Medien mit der in Film und Fernsehen, analysiert die Faszination virtueller Gewalt und präsentiert ausgewählte Studien zur Wirkung von Computerspielgewalt. Die Besonderheiten von Ego-Shootern wie "Doom" werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mediengewalt, Aggression, Gewaltforschung, Filmgewalt, Fernsehgewalt, Computerspielgewalt, Videospielgewalt, Wirkungsforschung, Inhaltsanalyse, Katharsisthese, Stimulationsthese, Lerntheorie, öffentliche Diskussion, Jugendgewalt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Zusammenfassung und der Ausblick des letzten Kapitels fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen und geben einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen im Bereich der Mediengewalt und deren Wirkung auf Kinder und Jugendliche.
- Citation du texte
- Frederik Henrich (Auteur), 2003, Medial erlebte Gewalt und aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen. Zusammenhänge, Gründe und Veränderungen in Schule, Familie und Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18169