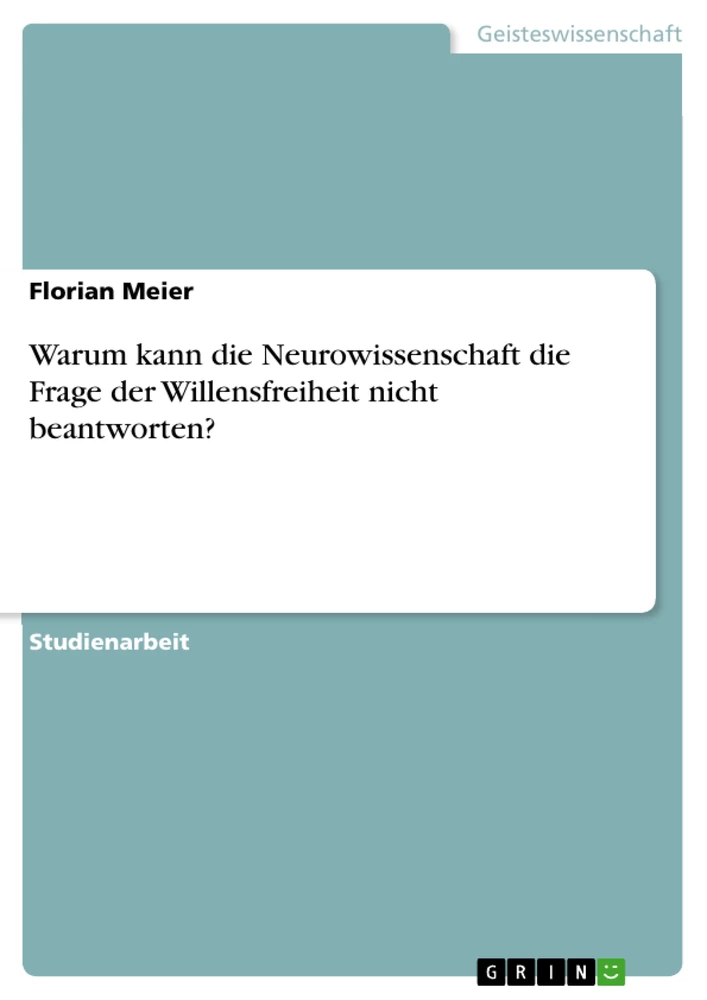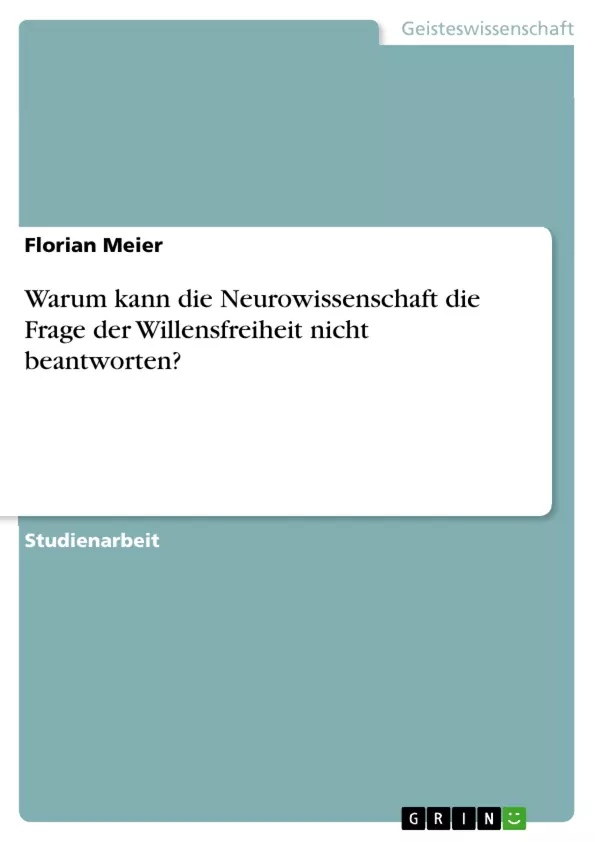„Des Menschen Wille, das ist sein Glück“ – Dieses Zitat stammt von Friedrich von Schiller und reißt eine Thematik der Wissenschaft an, deren Ausmaß heute kaum mehr überschaubar ist. Bereits Platon philosophierte vor mehr als zwei Jahrtausenden in seiner Seelenlehre darüber, was es mit dem Willen des Menschen auf sich hat. Etabliert hat sich über den Zeitraum ein bis heute währender wissenschaftlicher Disput verschiedener Fachrichtungen, aber auch allerhand Positionen innerhalb einzelner Fächer, ob denn so etwas wie Willensfreiheit existent ist oder nicht. Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten ein relativ neuer Wissenschaftszweig vehement in die Diskussion eingemischt. Es handelt sich dabei um die Neurowissenschaften, die sich aufgrund ihrer Erkenntnisse der letzten Jahre dazu befähigt sieht, bei der Frage der Willensfreiheit neue Antworten liefern zu können.
Dabei vertritt eine Reihe von Vertretern des Faches (wie Wolf Singer und Gerhard Roth), die Meinung, dass wir uns von unserem heute gängigen Bild des Menschen, der einen freien Willen besitzt, verabschieden müssen. Sind Gedanken, Wünsche und letztendlich Entscheidungen nur das Ergebnis neuronaler Impulse und Prozesse im Gehirn und wird so unser Gefühl des Bewusstseins produziert? Oder allgemeiner formuliert: Sind wir in unserer Entscheidungsfindung in irgendeiner Art determiniert?
In dieser Ausarbeitung wird dargelegt werden, warum die Neurowissenschaft die Frage nach der Existenz eines freien Willens gegenwärtig nicht beantworten kann. Um eine Grundlage zu bieten, worauf die Diskussion um die Willensfreiheit zwischen der Hirnforschung und Philosophie zurückgeht, werden im Folgenden zunächst die Hauptargumente, die einerseits gegen und andererseits für einen freien Willen sprechen, dargelegt werden. Darauffolgend werden im nächsten Kapitel sprachkritische Einwände von Maxwell Bennett und Peter Hacker an der Neurowissenschaft vorgestellt werden. Diesem Kapitel schließt sich dann eine Zusammenfassung von Peter Janichs Werk „Kein neues Menschenbild“ an. Er kritisiert ebenfalls die Sprache der Hirnforschung. Ziel ist es, in dieser Ausarbeitung zu zeigen, dass die Disziplin der Hirnforschung zunächst einmal ihre eigene Fachsprache entwickeln und gewisse sprachliche Schwächen überwinden muss. Am Ende der Ausarbeitung werden die wesentlichen Punkte der kritischen Einwände noch einmal zusammengefasst und ein abschließendes Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Argumente, die gegen die Willensfreiheit sprechen
- 2.1. Libets Nachweis von neurophysiologischen Vorbereitungen im Gehirn
- 2.2. Aufgezwungene Gehirnaktivitäten, die als „eigener Wille“ interpretiert werden
- 3. Argumente, die für die Willensfreiheit sprechen
- 3.1. Die subjektive Primärevidenz von Entscheidungsfreiheit
- 3.2. Das Argument des ganzen Ich's
- 4. Die Kritik von Maxwell Bennett und Peter Hacker an der Neurowissenschaft
- 4.1. Die Sprachkritik und der mereologische Fehlschluss
- 4.2. Die Kritik an der Reduktion der qualitativen Beschaffenheit von Bewusstsein und Erfahrung
- 5. Die Kritik von Peter Janich an der Neurowissenschaft
- 5.1. Die generelle Problematik der neurowissenschaftlichen Sprache
- 5.2. Kritik der Objektsprache
- 5.3. Kritik der Parasprache
- 5.4. Kritik der Metasprache
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Frage, warum die Neurowissenschaft die Frage der Willensfreiheit derzeit nicht beantworten kann. Sie beleuchtet die Debatte um Willensfreiheit aus neurowissenschaftlicher und philosophischer Perspektive. Die Arbeit analysiert sowohl Argumente für als auch gegen die Existenz eines freien Willens und prüft kritische Einwände gegen die neurowissenschaftliche Herangehensweise an dieses Thema.
- Die Argumente für und gegen die Willensfreiheit aus neurowissenschaftlicher Sicht
- Sprachkritische Analyse der neurowissenschaftlichen Methodik
- Bewertung der Grenzen der neurowissenschaftlichen Erklärungskraft im Bezug auf das Bewusstsein
- Die Rolle der subjektiven Erfahrung in der Debatte um die Willensfreiheit
- Philosophische Gegenpositionen zur neurowissenschaftlichen Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Willensfreiheit ein und skizziert den wissenschaftlichen Disput um deren Existenz. Sie stellt die Neurowissenschaft als einen relevanten, aber nicht allein entscheidenden Akteur in dieser Debatte vor und benennt die Zielsetzung der Arbeit: zu zeigen, warum die Neurowissenschaft die Frage nach der Willensfreiheit gegenwärtig nicht beantworten kann. Die Arbeit kündigt die Struktur an, indem sie die Darstellung gegensätzlicher Argumente und anschließender sprachkritischer Analysen ankündigt.
2. Argumente, die gegen die Willensfreiheit sprechen: Dieses Kapitel präsentiert neurowissenschaftliche Argumente gegen die Willensfreiheit. Es erläutert Libets Experiment, das eine zeitliche Vorwegnahme neuronaler Aktivität vor bewussten Entscheidungen zu zeigen scheint, und diskutiert Versuche, bei denen aufgezwungene Gehirnaktivitäten als „eigener Wille“ interpretiert werden. Dabei werden die Grenzen dieser Interpretationen, insbesondere die Fähigkeit des Gehirns, aus unvollständigen Informationen sinnvolle Konstruktionen zu erstellen, angesprochen.
3. Argumente, die für die Willensfreiheit sprechen: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel werden hier philosophische Argumente für die Willensfreiheit dargelegt. Der Fokus liegt auf der subjektiven Primärevidenz von Entscheidungsfreiheit, also der unmittelbaren, innerweltlichen Erfahrung des freien Willens. Die Problematik, diese subjektive Erfahrung mit objektiv-neurowissenschaftlichen Modellen zu vereinbaren, wird thematisiert. Das Argument des "ganzen Ichs" wird kurz angerissen.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Neurowissenschaften, Bewusstsein, Determinismus, Libet-Experiment, Sprachkritik, Philosophie, Subjektive Erfahrung, Hirnforschung, Neurophysiologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Willensfreiheitsdebatte aus neurowissenschaftlicher und philosophischer Perspektive
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, warum die Neurowissenschaft die Frage der Willensfreiheit derzeit nicht beantworten kann. Sie analysiert die Debatte aus neurowissenschaftlicher und philosophischer Sicht, beleuchtet Argumente für und gegen die Willensfreiheit und prüft kritische Einwände gegen die neurowissenschaftliche Herangehensweise.
Welche Argumente gegen die Willensfreiheit werden vorgestellt?
Es werden neurowissenschaftliche Argumente präsentiert, insbesondere Libets Experiment, welches eine zeitliche Vorwegnahme neuronaler Aktivität vor bewussten Entscheidungen zu zeigen scheint. Weiterhin werden Fälle diskutiert, in denen aufgezwungene Gehirnaktivitäten als „eigener Wille“ interpretiert werden. Die Grenzen dieser Interpretationen und die Fähigkeit des Gehirns, aus unvollständigen Informationen sinnvolle Konstruktionen zu erstellen, werden thematisiert.
Welche Argumente für die Willensfreiheit werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert philosophische Argumente für die Willensfreiheit, vor allem die subjektive Primärevidenz von Entscheidungsfreiheit – die unmittelbare Erfahrung des freien Willens. Die Schwierigkeit, diese subjektive Erfahrung mit objektiv-neurowissenschaftlichen Modellen zu vereinbaren, wird hervorgehoben. Das Argument des „ganzen Ichs“ wird ebenfalls kurz angerissen.
Welche Kritik an der Neurowissenschaft wird geübt?
Die Arbeit beinhaltet eine sprachkritische Analyse der neurowissenschaftlichen Methodik, insbesondere die Kritik von Maxwell Bennett und Peter Hacker und Peter Janich. Die Kritikpunkte umfassen den mereologischen Fehlschluss, die Reduktion der qualitativen Beschaffenheit von Bewusstsein und Erfahrung sowie die generelle Problematik der neurowissenschaftlichen Sprache (Objektsprache, Parasprache, Metasprache).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Argumente für und gegen die Willensfreiheit aus neurowissenschaftlicher Sicht; sprachkritische Analyse der neurowissenschaftlichen Methodik; Bewertung der Grenzen der neurowissenschaftlichen Erklärungskraft im Bezug auf das Bewusstsein; die Rolle der subjektiven Erfahrung in der Debatte um die Willensfreiheit; und philosophische Gegenpositionen zur neurowissenschaftlichen Perspektive.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung; Argumente gegen die Willensfreiheit; Argumente für die Willensfreiheit; Kritik von Bennett & Hacker an der Neurowissenschaft; Kritik von Janich an der Neurowissenschaft; und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Willensfreiheit, Neurowissenschaften, Bewusstsein, Determinismus, Libet-Experiment, Sprachkritik, Philosophie, Subjektive Erfahrung, Hirnforschung, Neurophysiologie.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit wird im Text nicht explizit wiedergegeben, jedoch wird im Vorfeld deutlich gemacht, dass die Arbeit zeigen will, warum die Neurowissenschaft die Frage nach der Willensfreiheit gegenwärtig nicht beantworten kann.
- Quote paper
- Florian Meier (Author), 2011, Warum kann die Neurowissenschaft die Frage der Willensfreiheit nicht beantworten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181750