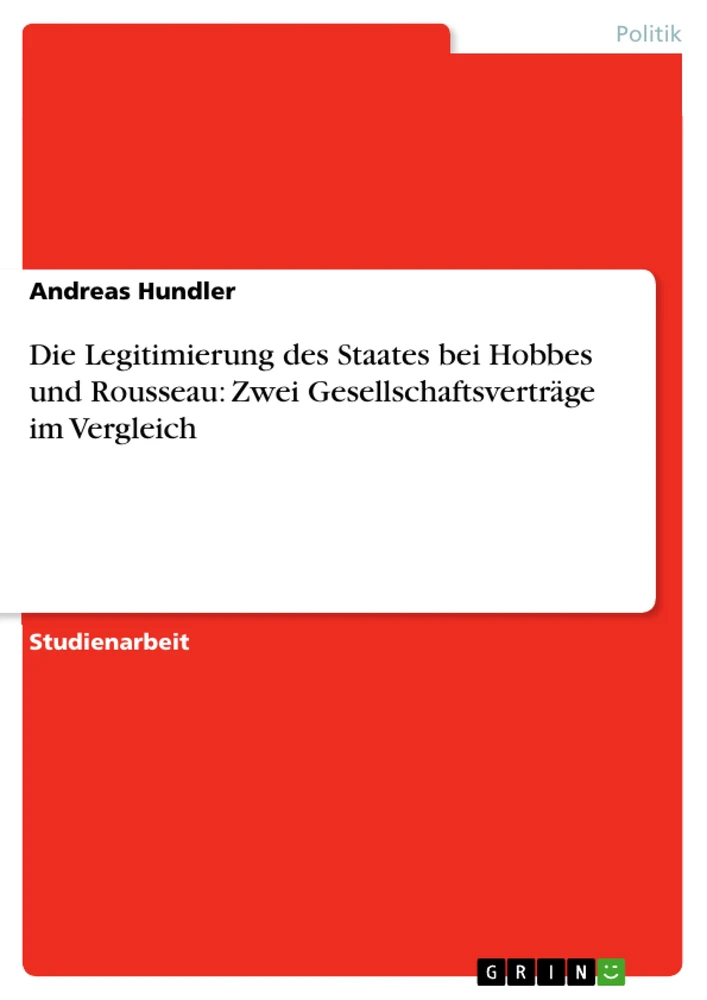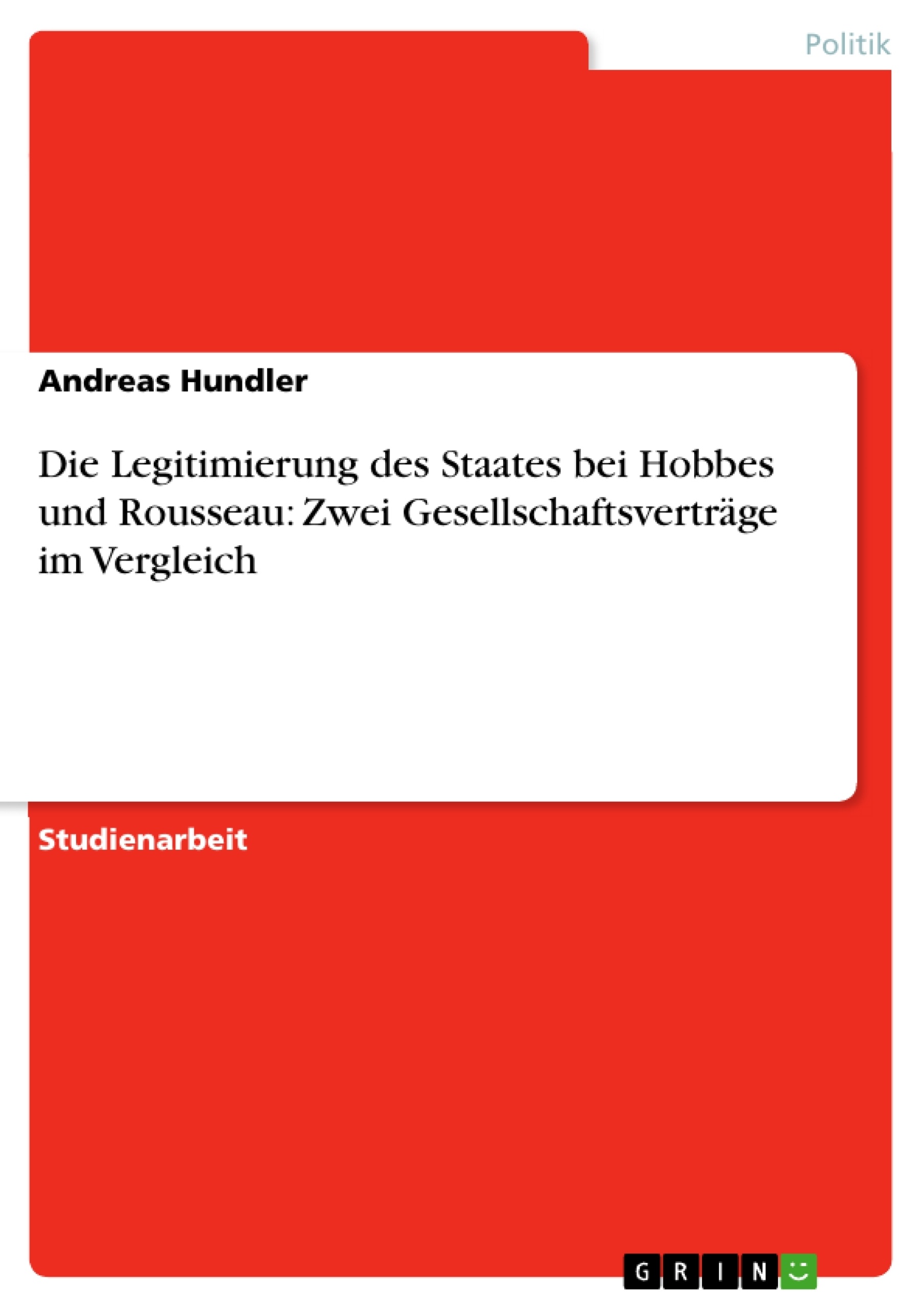Die Begründung und Legitimierung politischer Herrschaft ist bis heute Gegenstand zahlreicher politikphilosophischer Fragestellungen. Der Grund hierfür ist eindeutig: Es lässt sich kein Zustimmungsakt des Menschen ausmachen, in welchem er dem Staat, in den er alternativlos ohne jeglichen Entscheidungsspielraum hineingeboren wird, zustimmt und sich seiner Macht unterwirft. Der Gesellschaftsvertrag als ein Vertrag, in dem die Menschen der Gründung eines Staates und gleichermaßen ihrer eigenen Unterordnung unter die souveräne Macht zustimmen, ist die bedeutendste Argumentationsfigur der neuzeitlichen politischen Philosophie, mit deren Hilfe staatliche Gewalt legitimiert werden soll (vgl. Schmidt/Zintl 2009: 29). Der Philosoph und Vertragstheoretiker Thomas Hobbes hat in seinem bis heute viel diskutierten Werk „Leviathan“ dieses Vertragsargument ebenso zur Staatslegitimation genutzt wie der Vertragstheoretiker Jean-Jacques Rousseau, der im Jahr 1762 das Werk „Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundlagen des politischen Rechts“ veröffentlichte.
Sowohl Hobbes als auch Rousseau stellen in ihrer Philosophie der vertraglichen Übereinkunft zur Staatsgründung die Beschreibung eines Naturzustandes voran, womit ein vorstaatlicher Zustand ohne politische Herrschaft gemeint ist. Dieser Naturzustand ist für ihre Argumentationen von großer Bedeutung, denn er zeigt zum einen die Notwendigkeit eines Staates und somit Gesellschaftsvertrages auf, und er legt zum anderen die Gegebenheiten fest, unter denen dieser Vertrag abgeschlossen wird.
Der Akt des Gesellschaftsvertrages stellt das Herzstück beider vertragstheoretischer Philosophien dar. Durch ihn geht der Naturzustand durch menschliche Übereinkunft auf legitime Weise in einen Zustand staatlicher Herrschaft über. Aufgrund dieser herausragenden Bedeutsamkeit soll in dieser Hausarbeit ein Vergleich der Gesellschaftsverträge von Hobbes und Rousseau vorgenommen werden. Hierzu werden in den ersten zwei Kapiteln der Hausarbeit die Naturzustände sowie Gesellschaftsverträge beider Vertragstheoretiker getrennt voneinander beschrieben. Die Schilderung der Naturzustände sollen dem Leser die Einordnung des Gesellschaftsvertrages in das jeweilige kontraktualistische Gesamtkonzept ermöglichen. Im dritten Kapitel werden daraufhin die Gesellschaftsverträge beider Philosophen anhand der herausgearbeiteten Merkmale gegenübergestellt, um sowohl deren Gemeinsamkeiten als auch deren Unterschiede aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Naturzustand und Kontraktualismus bei Thomas Hobbes
- 2.1 Der Naturzustand in Thomas Hobbes' Werk „Leviathan“
- 2.1.1 Die empirischen Naturzustandsbedingungen
- 2.1.2 Die normativen Naturzustandsbedingungen
- 2.1.3 Die Staatsnotwendigkeit: Der Naturzustand als Kriegszustand
- 2.2 Der Gesellschaftsvertrag in Thomas Hobbes' Werk „Leviathan“
- 2.2.1 Die Vertragsstruktur und der Rechtsverzicht zugunsten des Souveräns
- 2.2.2 Die Autorisierung, Repräsentation und politische Einheit
- 2.2.3 Die personelle Bestimmung der souveränen Macht
- 2.1 Der Naturzustand in Thomas Hobbes' Werk „Leviathan“
- 3. Der Naturzustand und Kontraktualismus bei Jean-Jacques Rousseau
- 3.1 Der Naturzustand in Rousseaus Werk „Diskurs über die Ungleichheit“
- 3.1.1 Die menschliche Natur im Naturzustand vor jeder Vergesellschaftung
- 3.1.2 Die falsche Vergesellschaftung durch den Betrugsvertrag der Reichen
- 3.2 Der Gesellschaftsvertrag in Rousseaus Werk „Vom Gesellschaftsvertrag“
- 3.2.1 Die Vertragskonzeption, Rechtsgleichheit und die Erschaffung des Souveräns
- 3.2.2 Der Gemeinwille, die Gesetzgebung und die Regierung
- 3.2.3 Die natürliche und bürgerliche Freiheit
- 3.1 Der Naturzustand in Rousseaus Werk „Diskurs über die Ungleichheit“
- 4. Der Vergleich der Gesellschaftsverträge von Hobbes und Rousseau
- 4.1 Die Verwendung der Vertragsfigur und die Motivation zum Gesellschaftsvertrag
- 4.2 Der Gesellschaftsvertrag und Rechtsverzicht zur Erschaffung des Souveräns
- 4.3 Der Wille des Souveräns und die souveräne Machtausübung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Gesellschaftsverträge von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau, um die Legitimierung des Staates in ihren jeweiligen Werken zu vergleichen. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Konzeptionen des Naturzustandes, die Rolle des Rechtsverzichts und die Ausgestaltung der Staatsgewalt in beiden Theorien.
- Der Naturzustand als Ausgangspunkt der politischen Philosophie
- Der Gesellschaftsvertrag als Mittel zur Legitimierung staatlicher Herrschaft
- Der Vergleich der Hobbes'schen und der Rousseauschen Staatskonzeption
- Die Bedeutung des Rechtsverzichts und der souveränen Macht
- Die unterschiedlichen Vorstellungen von Freiheit und Gleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit behandelt den Naturzustand und den Gesellschaftsvertrag bei Thomas Hobbes. Es beschreibt die empirischen und normativen Bedingungen des Naturzustandes, die Hobbes als einen Zustand des Krieges ansieht. Hier wird die Notwendigkeit des Rechtsverzichts und die Bedeutung des Souveräns für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Frieden herausgestellt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Naturzustand und dem Gesellschaftsvertrag bei Jean-Jacques Rousseau. Hier wird die natürliche Freiheit und die menschliche Natur im Naturzustand sowie die Entstehung von Ungleichheit und Vergesellschaftung analysiert. Im dritten Kapitel werden die Gesellschaftsverträge von Hobbes und Rousseau anhand ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegenübergestellt. Es werden die unterschiedlichen Konzeptionen des Rechtsverzichts, die Gestaltung der Staatsgewalt und die Bedeutung des Gemeinwillens analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der politischen Philosophie wie Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Legitimität, Staatsgewalt, Recht, Freiheit, Gleichheit, Hobbes, Rousseau, Leviathan, Vom Gesellschaftsvertrag, Diskurs über die Ungleichheit.
- Citar trabajo
- Andreas Hundler (Autor), 2011, Die Legitimierung des Staates bei Hobbes und Rousseau: Zwei Gesellschaftsverträge im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181773