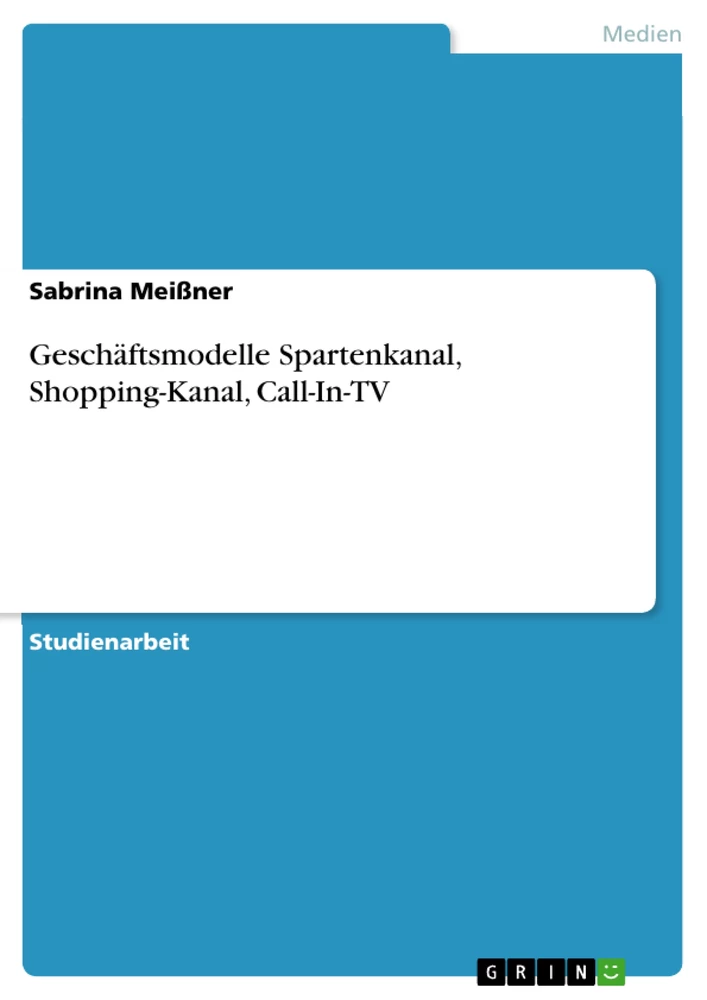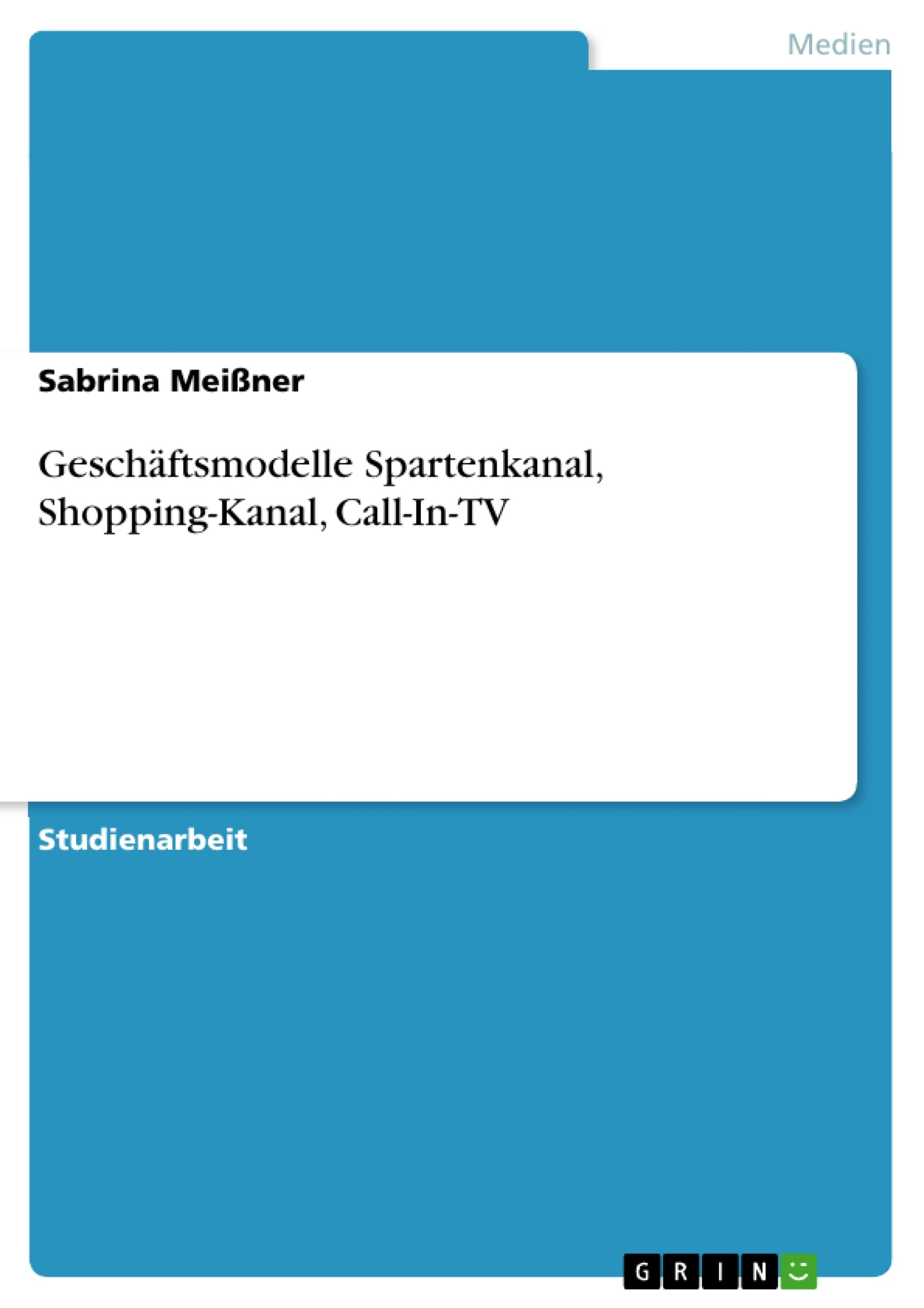In der ersten Generation des Fernsehzeitalters in Deutschland existierten allein die analogen, öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Erst seit 1984 weist Deutschland ein duales Rundfunksystem auf, welches das Nebeneinander von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern beinhaltet. Seit 1991 entwickelte sich durch fortschreitende technische Neuerungen das digitale Fernsehen, welches mehr Frequenzeffizienz vorweist und somit mehr Sender ausstrahlen kann. Aus diesem Grund entstanden ab dieser dritten TV-Generation zielgruppenspezifische Sparten- und Quiz-Sender wie 9Live oder QVC, die eine Interaktion vom Rezipienten verlangen. Anfang 2000 kam es in der vierten Generation aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung zu einem weiteren Ausbau des Spartensenderangebots. Laut Goldmedia befinden wir uns im Moment in der fünften TV-Generation, der Phase der sogenannten „Mesomedien“ , d.h. der Medien für Kleinstzielgruppen. Durch die Digitalisierung stieg die Anzahl der TV-Programme auf 1.000 und mehr an.
Laut dem statistischen Bundesamt Deutschland besaßen im Jahr 2004 95% der deutschen Haushalte mindestens einen Fernseher. 40% nutzten sogar zwei oder mehr Geräte. Dies beweist, dass die technischen Voraussetzungen für den TV-Konsum gegeben sind. Laut der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) stieg die tägliche Sehdauer pro Tag pro Person ab drei Jahren seit 2000 stetig an. Im Jahr 2009 lag die durchschnittliche Sehdauer der Zuschauer ab 3 Jahren bei 212 Minuten (3h 32min). Im darauffolgenden Jahr 2010 ist bereits eine deutliche Steigerung auf 223 Minuten (3h 43min) zu vermerken. Im Vergleich zu den 223 Minuten TV-Konsum hörten die Deutschen 2010 laut der Langzeitstudie „Massenkommunikation“ der ARD und des ZDF im Schnitt 187 Minuten Radio. Damit machten TV und Radio in etwa zwei Drittel des täglichen Medienkonsums aus. Dagegen stand das Internet 2010 mit 83 Nutzungsminuten. Es handelt sich dabei um das Medium mit dem größten Zuwachs, da es im Jahr 2005 erst 44 Minuten verzeichnete. Tageszeitungen wurden im Durchschnitt 23 Minuten, Bücher 22 Minuten und Zeitschriften 6 Minuten gelesen und spielen somit eine untergeordnete Rolle.
Diese Zahlen beweisen, dass das Fernsehen noch immer das aufmerksamkeitsstärkste Medium darstellt. Dies reizt die dahinterstehenden wirtschaftsorientierten Medienunternehmen. Neben den Einnahmen über den Werbemarkt sowie über die Rundfunkgebühren sind die Unternehmen auf der Suche nach weiteren bzw. neuen Ertragsmodellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spartenkanal
- Definition
- Nutzenversprechen
- Architektur der Wertschöpfung
- Ertragsmodell
- Private Spartenprogramme
- Werbeeinnahmen
- Pay-TV
- Öffentlich-rechtliche Anbieter
- Private Spartenprogramme
- Shopping-Kanäle
- Definition
- Nutzenversprechen
- Architektur der Wertschöpfung
- Ertragsmodell
- Call-In-TV
- Definition
- Nutzenversprechen
- Architektur der Wertschöpfung
- Ertragsmodell
- Zusammenfassung
- Ausblick
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Geschäftsmodelle im Fernsehbereich, fokussiert auf Spartenkanäle, Shopping-Kanäle und Call-In-TV. Ziel ist es, die jeweiligen Definitionen, Nutzenversprechen, Wertschöpfungsarchitekturen und Ertragsmodelle dieser Kanäle zu analysieren und zu vergleichen.
- Analyse verschiedener Fernseh-Geschäftsmodelle
- Vergleich der Wertschöpfungsarchitekturen
- Untersuchung der Ertragsmodelle
- Bewertung der jeweiligen Nutzenversprechen
- Entwicklung des Fernsehmarktes und seine Einflussfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung des deutschen Fernsehmarktes von den öffentlich-rechtlichen Anfängen bis zur heutigen Vielfalt an Spartensendern. Sie unterstreicht die zunehmende Digitalisierung und den damit verbundenen Anstieg an TV-Programmen sowie die steigende tägliche Sehdauer. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit neuer Ertragsmodelle für Medienunternehmen angesichts der bestehenden Werbe- und Rundfunkgebühren-Einnahmen.
Spartenkanal: Dieses Kapitel definiert den Spartenkanal und beschreibt sein Nutzenversprechen für Zuschauer und Anbieter. Die Architektur der Wertschöpfung wird detailliert dargestellt, wobei zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Anbietern unterschieden wird. Die verschiedenen Ertragsmodelle, insbesondere Werbeeinnahmen und Pay-TV, werden eingehend analysiert und ihre Vor- und Nachteile beleuchtet. Der Zusammenhang zwischen Zielgruppenansprache und der Entwicklung des digitalen Fernsehens wird hervorgehoben.
Shopping-Kanäle: Das Kapitel zu Shopping-Kanälen beschreibt deren Definition und ihr spezifisches Nutzenversprechen, das auf direktem Verkauf über das Fernsehen basiert. Die Architektur der Wertschöpfung, inklusive der logistischen und vertrieblichen Aspekte, wird analysiert. Das Ertragsmodell, welches im Wesentlichen auf dem direkten Produktverkauf beruht, wird detailliert untersucht und im Kontext anderer Fernsehmodelle eingeordnet. Der Einfluss des digitalen Fernsehens auf die Effizienz und Reichweite dieser Kanäle wird betrachtet.
Call-In-TV: Der Abschnitt zu Call-In-TV definiert diesen Kanal und erläutert das Nutzenversprechen sowohl für die Zuschauer (Interaktion, Gewinne) als auch für die Anbieter (hohe Erträge). Die Architektur der Wertschöpfung, mit ihren komplexen technischen und rechtlichen Aspekten, wird präzise beschrieben. Das Ertragsmodell, welches maßgeblich auf den Gebühren der Anrufer basiert, wird im Detail untersucht. Die ethischen und rechtlichen Implikationen dieser Form des Fernsehens werden zumindest implizit angesprochen.
Schlüsselwörter
Spartenkanal, Shopping-Kanal, Call-In-TV, Geschäftsmodell, Wertschöpfung, Ertragsmodell, Digitalisierung, Pay-TV, Werbeeinnahmen, Medienwirtschaft, Fernsehmarkt, Zielgruppenansprache, duales Rundfunksystem.
FAQ: Analyse verschiedener Fernseh-Geschäftsmodelle
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert verschiedene Geschäftsmodelle im deutschen Fernsehbereich, konzentriert sich dabei auf Spartenkanäle, Shopping-Kanäle und Call-In-TV. Sie untersucht Definitionen, Nutzenversprechen, Wertschöpfungsarchitekturen und Ertragsmodelle dieser Kanäle und vergleicht diese miteinander.
Welche Geschäftsmodelle werden untersucht?
Die Arbeit fokussiert auf drei Haupttypen von Fernseh-Geschäftsmodellen: Spartenkanäle, Shopping-Kanäle und Call-In-TV. Jedes Modell wird einzeln analysiert und im Vergleich zu den anderen betrachtet.
Was sind die zentralen Aspekte der Analyse für jedes Geschäftsmodell?
Für jedes Geschäftsmodell werden folgende Aspekte analysiert: Definition, Nutzenversprechen (für Zuschauer und Anbieter), Architektur der Wertschöpfung und Ertragsmodell. Zusätzlich wird der Einfluss der Digitalisierung und des deutschen dualen Rundfunksystems berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Spartenkanälen, Shopping-Kanälen und Call-In-TV, eine Zusammenfassung, einen Ausblick und ein Quellenverzeichnis. Jedes Kapitel folgt einem einheitlichen Aufbau, der die oben genannten Aspekte umfasst.
Welche Ertragsmodelle werden im Detail untersucht?
Bei Spartenkanälen werden Werbeeinnahmen und Pay-TV-Modelle detailliert untersucht. Shopping-Kanäle basieren primär auf dem direkten Produktverkauf. Call-In-TV generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch Gebühren der Anrufer.
Wie wird die Wertschöpfungsarchitektur analysiert?
Die Analyse der Wertschöpfungsarchitektur beschreibt die verschiedenen Akteure, Prozesse und Beziehungen, die zur Erstellung und Bereitstellung der jeweiligen Fernsehprogramme notwendig sind. Dabei wird auch die Rolle der Digitalisierung und die Unterschiede zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Anbietern berücksichtigt.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung?
Die Digitalisierung des Fernsehmarktes wird als wichtiger Einflussfaktor für alle drei Geschäftsmodelle betrachtet. Sie beeinflusst die Reichweite, die Effizienz und die Entwicklung neuer Ertragsmodelle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spartenkanal, Shopping-Kanal, Call-In-TV, Geschäftsmodell, Wertschöpfung, Ertragsmodell, Digitalisierung, Pay-TV, Werbeeinnahmen, Medienwirtschaft, Fernsehmarkt, Zielgruppenansprache, duales Rundfunksystem.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Fernseh-Geschäftsmodelle zu analysieren, zu vergleichen und ein umfassendes Verständnis ihrer Funktionsweisen und ihrer Entwicklung im Kontext des sich verändernden Medienmarktes zu liefern.
Gibt es einen Ausblick in der Arbeit?
Ja, die Arbeit enthält einen Ausblick, der mögliche zukünftige Entwicklungen und Trends der analysierten Geschäftsmodelle im Fernsehbereich diskutiert.
- Quote paper
- BA Sabrina Meißner (Author), 2011, Geschäftsmodelle Spartenkanal, Shopping-Kanal, Call-In-TV, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181890