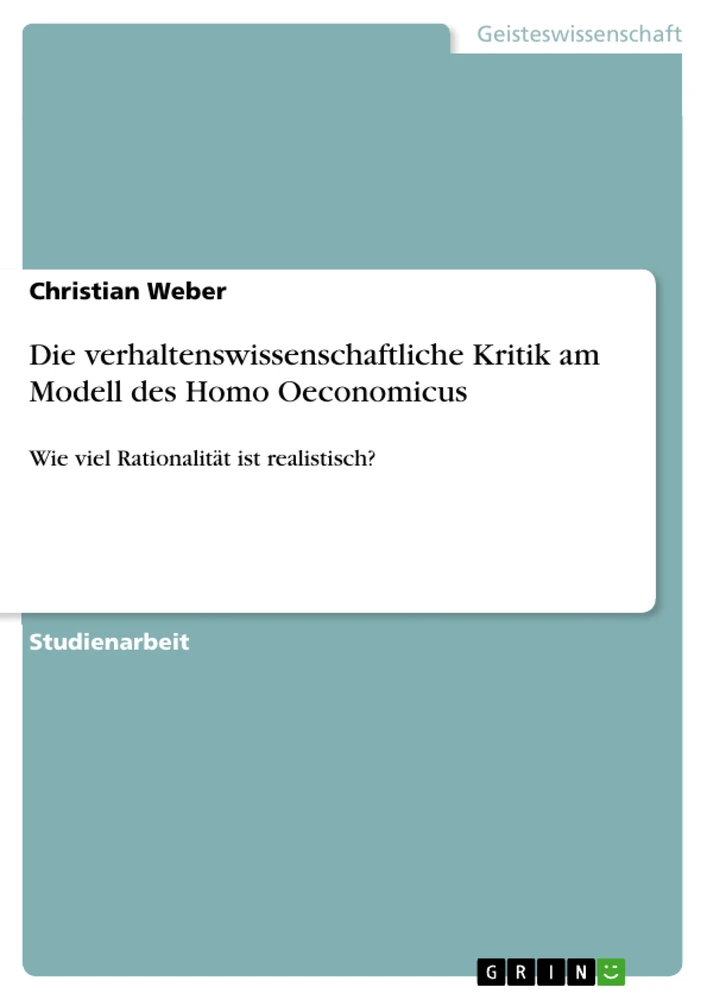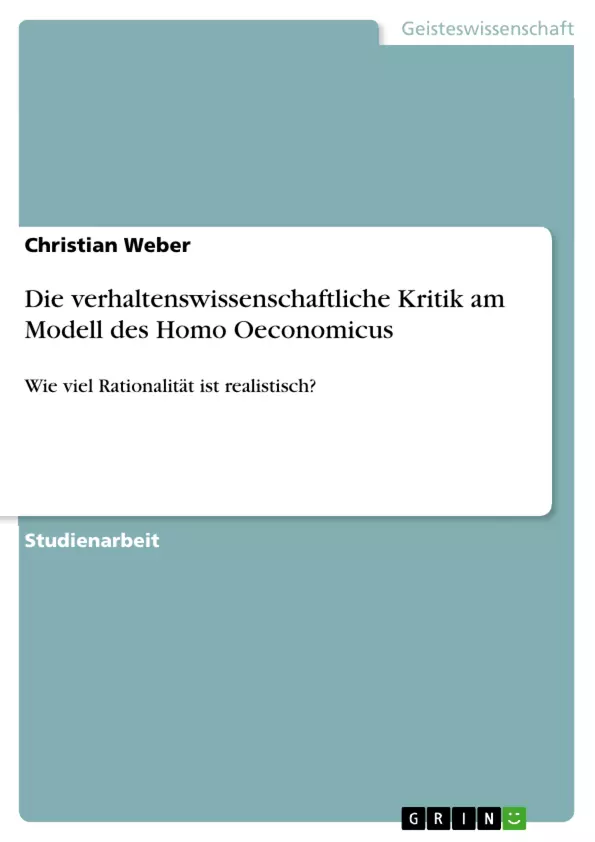Von Organisationen wird gemeinhin erwartet, Prozesse, Ziele und Abläufe derart zu planen, dass durch Organisieren Ordnung geschaffen wird. In der Realität zeigt sich aber, dass dieses Ziel oftmals verfehlt wird und aus vielfältigen Gründen Unordnung entstehen kann. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Plan und Chaos findet sich auch in einem ausschlaggebenden Aspekt der Organisation, nämlich dem des Entscheidens wieder. Gemeinhin bestehen Organisationen aus Individuen, die die organisationalen Zwecke und Ziele zumindest der Intention nach rational verfolgen (vgl. JANSEN 2006, S. 8 ff). Aus diesen Prämissen ergibt sich für die vorliegende Arbeit folgende Fragestellung:
Wie rational können Entscheidungen in Organisationen sein?
Die Analyse findet auf der Mikroebene der Organisation statt, individuelle Wahlhandlungen dienen als Erklärungsfigur (vgl. JANSEN, S. 19). Demnach ist das Modell des "homo oeconomicus", auch als Rational-Choice-Modell bekannt, so etwas wie der "Urmensch" der Wirtschafts- als auch der Sozialwissenschaften. Auf ihm und vor allem auf der Kritik an ihm bauen weitergehende Betrachtungen der wissenschaftlichen Forschung auf. Die Fundamentalkritik an der vom "homo oeconomicus" angestrebten vollkommenen Rationalität bildet die Grundlage für die "Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie", einer Forschungsrichtung innerhalb der Organisationssoziologie. Mithilfe dieser Theorie soll die o.g. Frage beantwortet werden.
Im Anschluss an die Beschreibung des „homo oeconomicus“, wird in die "Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie" eingeführt, die Kritik am "homo oeconomicus" konkretisiert und das alternative Modell des "homo organisans" vorgestellt. Im weiteren Verlauf werden Entscheidungsregeln und Beeinflussungsmechanismen von Organisationen erläutert, die auf das Handeln ihrer Mitglieder einwirken. Unter dem Gesichtspunkt der Rationalität wird danach untersucht, wie Ziele und Erwartungen der Organisationsteilnehmer in Ziele der Organisation umgesetzt werden. Schließlich wird mit dem Papierkorb-Modell eine Methode für organisationales Entscheiden diskutiert, das von der ursprünglichen Rationalitätsanforderung nicht mehr viel übrig lässt. Das abschließende Fazit fasst die gesammelten Erkenntnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Homo Oeconomicus“
- Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie
- „Homo Organisans“
- Mechanismen der Organisation
- Der Zielbildungsprozess
- Das „Papierkorbmodell“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rationalität von Entscheidungen in Organisationen auf Mikroebene. Sie hinterfragt das klassische Modell des „homo oeconomicus“ und beleuchtet, wie Verhaltensmuster und organisationale Einflüsse die Entscheidungsfindung beeinflussen.
- Kritik am Modell des „homo oeconomicus“
- Einführung des „homo organisans“ als alternatives Modell
- Entscheidungsmechanismen und -regeln in Organisationen
- Der Prozess der Zielbildung in Organisationen
- Das „Papierkorbmodell“ als Beispiel für organisationales Entscheiden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rationalität von Entscheidungen in Organisationen. Sie begründet die Wahl des methodischen Ansatzes, der sich auf die Mikroebene der individuellen Wahlhandlungen konzentriert und das Modell des „homo oeconomicus“ als Ausgangspunkt nimmt. Die Arbeit kündigt die folgenden Kapitel an, die die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie, das Modell des „homo organisans“, Entscheidungsmechanismen und das „Papierkorbmodell“ behandeln.
„Homo Oeconomicus“: Dieses Kapitel beschreibt das Modell des „homo oeconomicus“, das davon ausgeht, dass Individuen rational und nutzenmaximierend handeln. Es erläutert die Präferenzordnung, die Kosten-Nutzen-Abwägung und die Einflussfaktoren wie Knappheit und Restriktionen. Verschiedene entscheidungstheoretische Modelle werden erwähnt, die das Idealbild des perfekt rationalen Entscheidens abbilden. Der Abschnitt schließt mit einem Ausblick auf die Kritik an diesem Modell, die im folgenden Kapitel vertieft wird.
Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie: Dieses Kapitel präsentiert die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie als Gegenmodell zum „homo oeconomicus“. Es kritisiert die Annahme der vollkommenen Rationalität und betont die begrenzten kognitiven Fähigkeiten des Menschen. SIMONS Kritik an der neoklassischen Organisationstheorie und die Einführung des Konzepts der „begrenzten Rationalität“ bilden den Kern dieses Kapitels. Die Bedeutung von Motivation und Anreizen für das Entscheidungsverhalten in Organisationen wird angerissen, unter Bezugnahme auf Barnard und Simon.
Schlüsselwörter
Homo oeconomicus, Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie, Homo organisans, begrenzte Rationalität, Entscheidungsmechanismen, Zielbildungsprozess, Papierkorbmodell, Organisationssoziologie.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie in Organisationen
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich mit der Rationalität von Entscheidungen in Organisationen auf Mikroebene. Er hinterfragt das klassische Modell des „homo oeconomicus“ und untersucht, wie Verhaltensmuster und organisationale Einflüsse die Entscheidungsfindung beeinflussen.
Welche Modelle werden im Text behandelt?
Der Text behandelt das Modell des „homo oeconomicus“, das von rationalem und nutzenmaximierenden Handeln ausgeht, und setzt dem die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie und das Modell des „homo organisans“ entgegen. Letzteres berücksichtigt die begrenzten kognitiven Fähigkeiten des Menschen und organisationale Einflüsse auf Entscheidungen.
Was ist der „homo oeconomicus“?
Der „homo oeconomicus“ ist ein Modell, das Individuen als rational und nutzenmaximierend darstellt. Es basiert auf einer Präferenzordnung, Kosten-Nutzen-Abwägungen und berücksichtigt Knappheit und Restriktionen. Der Text kritisiert dieses Modell als unrealistisch.
Was ist der „homo organisans“?
Der „homo organisans“ ist ein alternatives Modell zum „homo oeconomicus“. Er berücksichtigt die begrenzte Rationalität des Menschen und den Einfluss organisationaler Strukturen und Prozesse auf die Entscheidungsfindung. Er rückt Motivation und Anreize in den Mittelpunkt.
Welche Kritikpunkte werden am „homo oeconomicus“ geübt?
Der Text kritisiert die Annahme vollkommener Rationalität beim „homo oeconomicus“ und betont die begrenzten kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Die Berücksichtigung von organisationalen Einflüssen und die Komplexität realer Entscheidungssituationen werden als wesentliche Kritikpunkte genannt.
Welche Rolle spielen Entscheidungsmechanismen und -regeln in Organisationen?
Der Text untersucht, wie Entscheidungsmechanismen und -regeln in Organisationen die Entscheidungsfindung beeinflussen. Er betont, dass diese Mechanismen die individuelle Entscheidungsfreiheit einschränken und die Resultate prägen können.
Was ist der Zielbildungsprozess in Organisationen und welche Bedeutung hat er?
Der Text befasst sich mit dem Prozess der Zielbildung in Organisationen und seiner Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Die Formulierung von Zielen beeinflusst die Auswahl von Handlungsoptionen und die Bewertung von Ergebnissen.
Was ist das „Papierkorbmodell“?
Das „Papierkorbmodell“ ist ein Beispiel für organisationales Entscheiden, das die Zufälligkeit und die Unvorhersehbarkeit von Entscheidungsprozessen betont. Es zeigt, wie Probleme, Lösungen, Teilnehmer und Entscheidungsmöglichkeiten in einem „Papierkorb“ zusammenkommen und zu Entscheidungen führen können, die nicht immer rational sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Homo oeconomicus, Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie, Homo organisans, begrenzte Rationalität, Entscheidungsmechanismen, Zielbildungsprozess, Papierkorbmodell, Organisationssoziologie.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zum „Homo Oeconomicus“, ein Kapitel zur verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie und ein Fazit.
- Citar trabajo
- Christian Weber (Autor), 2011, Die verhaltenswissenschaftliche Kritik am Modell des Homo Oeconomicus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181911