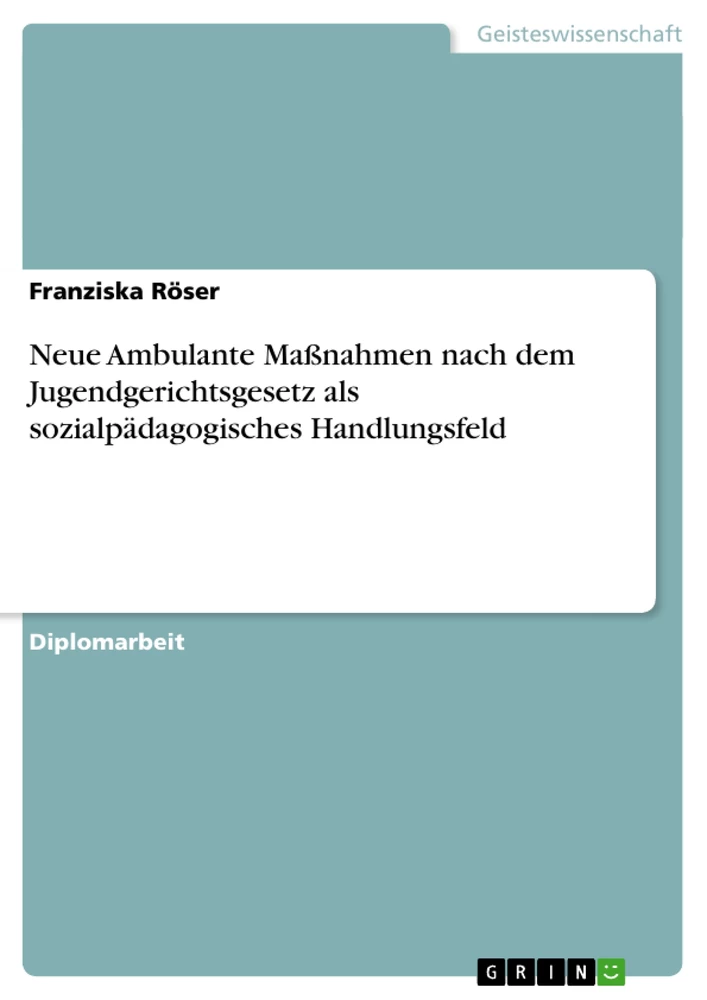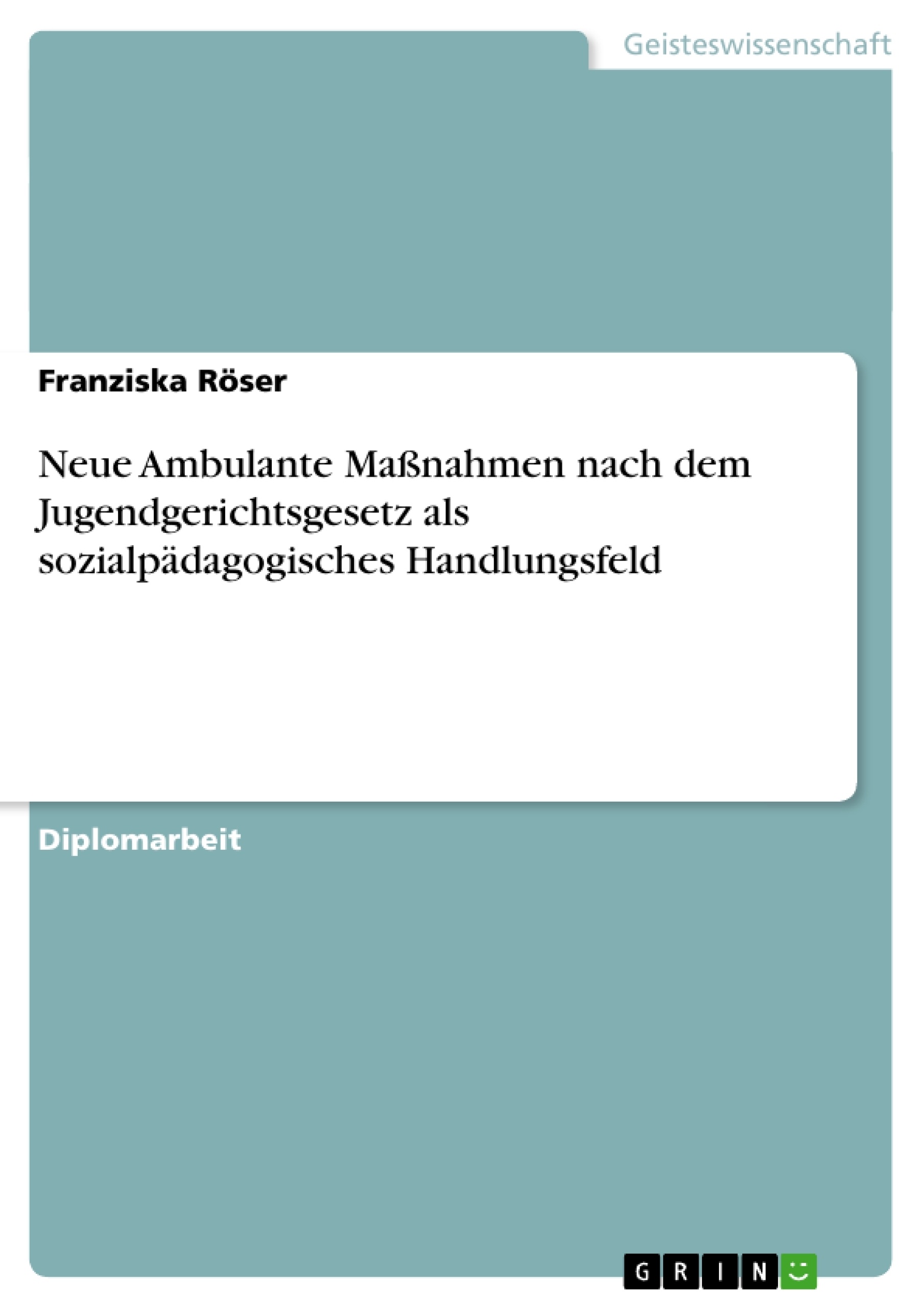Jugendkriminalität steht heute zunehmend im Blick der Öffentlichkeit.
Aus einer Südthüringer Tageszeitung vom 05.05.2003 lässt sich entnehmen, dass
der Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung zwar abnimmt, die
Jugendkriminalität jedoch gleichzeitig ansteigt.
Prof. Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen
gibt an, dass die Kriminalstatistik 2002 die höchste je in Deutschland gemessene
Jugendkriminalitätsrate ausweist (vgl. Freies Wort 05.05.2003 „Immer mehr junge
Kriminelle bewaffnen sich“).
Auch der stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundes deutscher
Kriminalbeamter, Holger Bernsee, verweist auf einen Anstieg der
Jugendkriminalität, wobei gerade junge Männer im Bereich der Gewaltkriminalität
immer stärker ins Rampenlicht rücken (vgl. ebda.).
Berlins Innensenator Erhart Korting (SPD) sieht diese Entwicklung ebenfalls mit
großer Besorgnis.
Die Zahl der von Jugendlichen verübten Raubtaten in der Bundeshauptstadt stieg
im Jahr 2002 um mehr als zehn Prozent, bei zunehmend brutaler Vorgehensweise
der jungen Täter (vgl. ebda.).
Angesichts dieser Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr
Stimmen laut werden, die das gegenwärtige Jugendkriminalrecht als unwirksam
und zu milde betrachten und statt dessen schärfere und härtere Reaktionen und
Strafen für jugendliche Delinquenten fordern.
Es gibt aber hierzu auch eine gegensätzliche Auffassung, die etwas ganz Anderes
für notwendig hält, nämlich bereits im Bereich der Prävention eine bessere,
frühzeitigere und somit wirksamere Zusammenarbeit von staatlichen Stellen,
Erziehern und Eltern.
Diese Diskussion beschäftigt die verschiedensten Personenkreise, wie
beispielsweise Politiker, Juristen, Eltern, Lehrer und Sozialarbeiter gleichermaßen.
Es wird versucht, die Ursachen und Entstehungszusammenhänge, den Umfang,
die Erscheinungsformen und Entwicklungstendenzen der Jugendkriminalität zu
erkennen und zu erklären, was allerdings bei sich ständig verändernden
gesellschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen nicht einfach ist.
Über das große Ziel, Jugendkriminalität zu vermindern oder am besten gar nicht erst entstehen zu lassen, sind sich alle einig. Auch darüber, dass ein junger
Mensch, der dennoch eine Verfehlung begangen hat, durch Einflussnahmen
verschiedenster Art dazu bewegt werden muss, in Zukunft ein normtreues und
straffreies Leben zu führen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendkriminalität
- Definition und Funktion des Begriffes „Jugendkriminalität“
- Sozialisatorische und entwicklungspsychologische Erklärungsansätze
- Anomietheorie
- Episodencharakter von Jugendkriminalität
- Zusammenhang von Sozialstruktur und Jugendkriminalität
- Jugendkriminalität in der Gruppe
- Sprach- und Interaktionskompetenz delinquenter Jugendlicher
- Die Labeling - Theorie
- Das Jugendgerichtsgesetz (JGG)
- Historische Entwicklung des Jugendkriminalrechts
- Sanktionszwecke des Jugendgerichtsgesetzes
- Das Schuld _ Sühne - Prinzip
- Funktion und Bedeutung von Strafe
- Prävention als Sanktionszweck im Jugendkriminalrecht
- Verhaltensändernde Wirkung von Sanktionen
- Das Diversionsverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Die jugendstrafrechtlichen Sanktionsformen
- Das Sanktionensystem
- Erziehungsmaßregeln
- Weisungen
- Hilfe zur Erziehung
- Zuchtmittel
- Verwarnung
- Auflagen
- Jugendarrest
- Jugendstrafe
- Erziehungsmaßregeln
- Auswahl und Bemessung der Sanktionsform
- Der Erziehungsgedanke
- Das Sanktionensystem
- Die Neuen Ambulanten Maßnahmen (NAM)
- Allgemeine Betrachtung
- Adressaten der Neuen Ambulanten Maßnahmen
- Arbeitsweisung und Arbeitsauflage
- Allgemeine Betrachtung
- Zielgruppe
- Durchführung
- Mindeststandards
- Betreuungsweisung
- Allgemeine Betrachtung
- Zielgruppe
- Durchführung
- Mindeststandards
- Sozialer Trainingskurs (STK)
- Allgemeine Betrachtung
- Zielgruppe
- Durchführung
- Mindeststandards
- Täter - Opfer - Ausgleich (TOA)
- Allgemeine Betrachtung
- Zielgruppe
- Durchführung
- Mindeststandards
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Neuen Ambulanten Maßnahmen (NAM) im Kontext des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Die Arbeit analysiert die Entwicklung und den Stellenwert dieser Maßnahmen im Rahmen des Jugendstrafrechts und untersucht deren Einsatzmöglichkeiten und -grenzen im Hinblick auf die Prävention und Behandlung von Jugendkriminalität.
- Entwicklung und Bedeutung des Jugendstrafrechts
- Konzepte und Ziele der Neuen Ambulanten Maßnahmen
- Die Rolle der NAM in der Prävention und Behandlung von Jugendkriminalität
- Zusammenhang zwischen Jugendkriminalität, sozialer Struktur und gesellschaftlichen Normen
- Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Umsetzung von NAM
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der aktuellen Situation der Jugendkriminalität in Deutschland und verdeutlicht die Notwendigkeit, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Kapitel 2 analysiert die Ursachen und Entwicklungen von Jugendkriminalität aus soziologischer und psychologischer Perspektive, während Kapitel 3 das Jugendgerichtsgesetz (JGG) und seine Sanktionszwecke beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit den verschiedenen Sanktionsformen im Jugendstrafrecht, einschließlich Erziehungsmaßnahmen, Zuchtmitteln und Jugendstrafen. Das 5. Kapitel steht im Zentrum der Arbeit und untersucht die Neuen Ambulanten Maßnahmen (NAM) im Detail. Hier werden die verschiedenen NAM-Formen wie Arbeitsweisung und Arbeitsauflage, Betreuungsweisung, Sozialer Trainingskurs (STK) und Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Neue Ambulante Maßnahmen (NAM), Prävention, Sanktionen, Erziehungsmaßnahmen, Zuchtmittel, Jugendstrafe, Arbeitsweisung, Betreuungsweisung, Sozialer Trainingskurs (STK), Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), Sozialstruktur, gesellschaftliche Normen, delinquentes Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Neue Ambulante Maßnahmen (NAM)?
NAM sind sanktionsersetzende oder -begleitende Maßnahmen im Jugendstrafrecht, die auf Erziehung statt auf Haft setzen, wie z.B. soziale Trainingskurse oder Täter-Opfer-Ausgleich.
Was ist das Ziel des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA)?
Ziel ist die außergerichtliche Schlichtung, bei der der Täter Verantwortung übernimmt und versucht, den entstandenen Schaden materiell oder immateriell wiedergutzumachen.
Was beinhaltet ein Sozialer Trainingskurs (STK)?
Ein STK soll die soziale Kompetenz und Konfliktfähigkeit delinquenter Jugendlicher stärken, um künftige Straftaten zu vermeiden.
Welchen Stellenwert hat der Erziehungsgedanke im JGG?
Im Jugendgerichtsgesetz steht die Erziehung im Vordergrund. Sanktionen sollen primär die künftige Lebensführung positiv beeinflussen und nicht nur strafen.
Was ist das Diversionsverfahren?
Es ist ein Verfahren, bei dem die Staatsanwaltschaft oder das Gericht auf eine formelle Strafe verzichtet, wenn der Jugendliche bestimmte Auflagen oder pädagogische Maßnahmen erfüllt.
- Arbeit zitieren
- Franziska Röser (Autor:in), 2003, Neue Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz als sozialpädagogisches Handlungsfeld, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18193