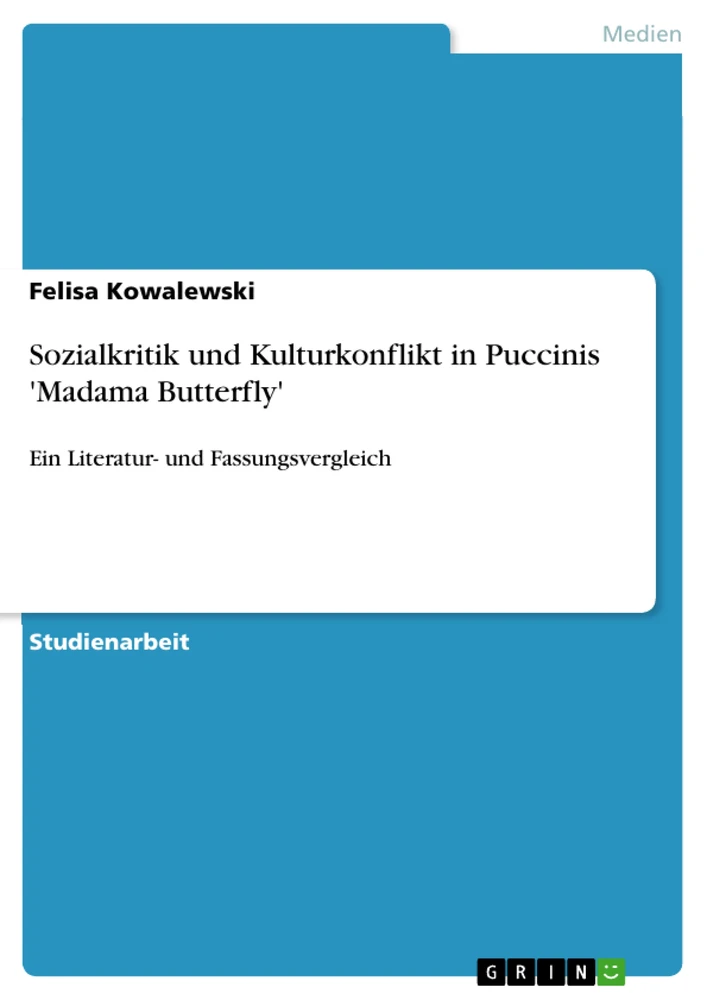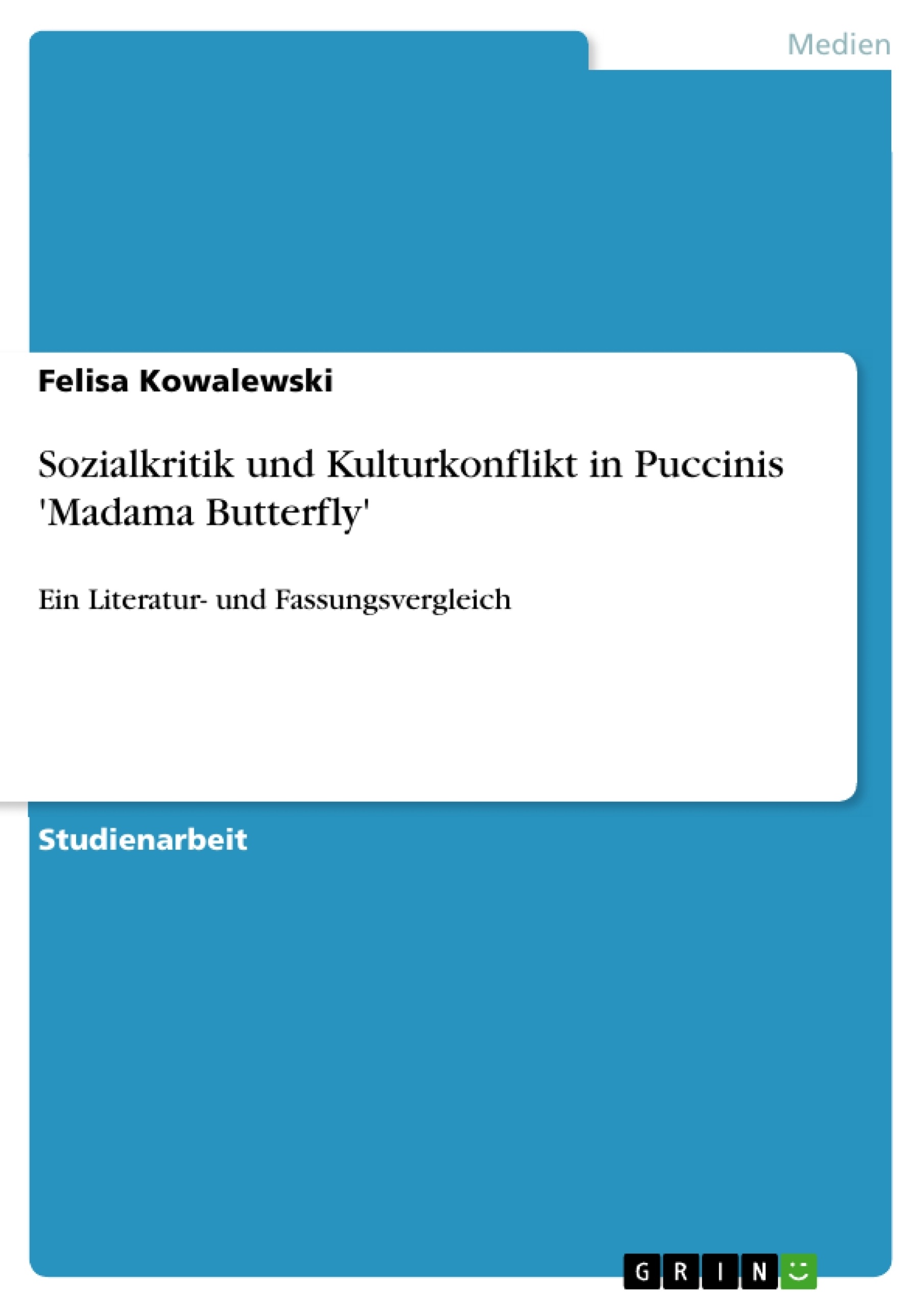Puccinis berühmte Oper Madame Butterfly ist eine der meist aufgeführten Opern der Welt. Nach einer katastrophalen Uraufführung in Mailand 1904 schrieb Puccini sie mehrmals um und nahm wesentliche Änderungen am Text vor, sodass sich heute mehrere Fassungen rekonstruieren lassen. Der Stoff der Oper geht zurück auf zwei Romane, Madame Chrysanthème von Pierre Loti und Madame Butterfly von John Luther Long, und ein Theaterstück, Madame Butterfly von David Belasco. Sie entstanden im Zuge des damals aufkommenden Japonismus (ca. 1855-1910), einer Strömung in Europa, besonders in Frankreich, die japanische Kunst in die eigene aufnimmt. Die Oper sowie die Bücher spielen in Japan und behandeln unter anderem das Aufeinanderprallen von Ost und West. Diese Arbeit soll die Quellen der Oper - die vorangegangene Literatur - sowie die Urfassung und die gängige Fassung unter dem Aspekt der Sozialkritik und des Kulturkonflikts betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Thematik
- 2.1 Vorgeschichte und Pierre Loti
- 2.2 John Luther Long und David Belasco
- 3. Puccinis Madama Butterfly
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehungsgeschichte von Puccinis Oper Madama Butterfly unter Berücksichtigung der sozialkritischen und kulturkonfliktären Aspekte. Sie vergleicht die literarischen Vorlagen mit der Opernfassung, um die Entwicklung der Thematik nachzuvollziehen und die Veränderungen im Hinblick auf die dargestellte Sozialkritik zu analysieren.
- Der Einfluss des Japonismus auf die Darstellung Japans und seiner Kultur
- Die Darstellung des Kulturkonflikts zwischen Ost und West
- Die sozialkritische Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Ausbeutung
- Die Entwicklung der Figur Cio-Cio-San und ihre Repräsentation der weiblichen Rolle
- Die verschiedenen Fassungen der Oper und ihre jeweiligen Interpretationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die vielschichtige Entstehungsgeschichte von Puccinis Oper Madama Butterfly. Sie hebt die Bedeutung der verschiedenen Fassungen der Oper hervor und benennt die literarischen Vorlagen – die Romane von Pierre Loti und John Luther Long sowie das Theaterstück von David Belasco – als Ausgangspunkt der Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Analyse der Sozialkritik und des Kulturkonflikts, die in den verschiedenen Versionen der Geschichte zum Ausdruck kommen.
2. Thematik: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte der Oper und die literarischen Quellen. Es beginnt mit der Darstellung der historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Japan während der Edo-Zeit, wobei der Handelshafen von Nagasaki und die Rolle japanischer Frauen als Ehefrauen von Seeleuten sowie als Spione hervorgehoben werden. Der autobiographische Roman „Madame Chrysanthème“ von Pierre Loti wird detailliert analysiert, wobei Lotis oberflächliche und respektlose Behandlung der japanischen Kultur und seiner Ehefrau im Mittelpunkt steht. Der Vergleich mit John Luther Longs „Madame Butterfly“ zeigt eine differenziertere und emotionalere Darstellung des Themas, die dennoch den kulturellen Konflikt zwischen Ost und West aufgreift und die Ausbeutung der Protagonistin verdeutlicht. Der Abschnitt beleuchtet somit die Transformation der Thematik von einer exotischen Darstellung hin zu einer sozialkritischeren Betrachtung.
Schlüsselwörter
Madama Butterfly, Puccini, Japonismus, Sozialkritik, Kulturkonflikt, Ost-West-Begegnung, Kolonialismus, Pierre Loti, John Luther Long, David Belasco, Cio-Cio-San, Tokugawa-Zeit, Nagasaki.
Häufig gestellte Fragen zu "Madama Butterfly": Entstehungsgeschichte und sozialkritische Aspekte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehungsgeschichte von Giacomo Puccinis Oper "Madama Butterfly" unter Berücksichtigung der sozialkritischen und kulturkonfliktären Aspekte. Sie vergleicht die literarischen Vorlagen mit der Opernfassung, um die Entwicklung der Thematik und die Veränderungen in der Sozialkritik nachzuvollziehen.
Welche literarischen Vorlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Romane "Madame Chrysanthème" von Pierre Loti und "Madame Butterfly" von John Luther Long sowie das Theaterstück von David Belasco als literarische Vorlagen für Puccinis Oper. Der Vergleich dieser Quellen ermöglicht es, die Transformation der Thematik von einer exotischen Darstellung hin zu einer sozialkritischeren Betrachtung zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des Japonismus auf die Darstellung Japans und seiner Kultur, dem Kulturkonflikt zwischen Ost und West, der sozialkritischen Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Ausbeutung, der Entwicklung der Figur Cio-Cio-San und ihrer Repräsentation der weiblichen Rolle sowie den verschiedenen Fassungen der Oper und ihren jeweiligen Interpretationen.
Wie wird die Vorgeschichte der Oper dargestellt?
Das Kapitel zur Thematik beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Japan während der Edo-Zeit, insbesondere den Handelshafen Nagasaki und die Rolle japanischer Frauen. Es analysiert detailliert Pierre Lotis "Madame Chrysanthème" und vergleicht sie mit John Luther Longs "Madame Butterfly", um die Unterschiede in der Darstellung des kulturellen Konflikts und der Ausbeutung der Protagonistin aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Madama Butterfly, Puccini, Japonismus, Sozialkritik, Kulturkonflikt, Ost-West-Begegnung, Kolonialismus, Pierre Loti, John Luther Long, David Belasco, Cio-Cio-San, Tokugawa-Zeit, Nagasaki.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Thematik (inkl. Vorgeschichte und Analyse der literarischen Vorlagen), ein Kapitel zu Puccinis Madama Butterfly und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die vielschichtige Entstehungsgeschichte und benennt die literarischen Vorlagen. Das Kapitel zur Thematik beleuchtet die Vorgeschichte und die literarischen Quellen detailliert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehungsgeschichte von Puccinis Oper "Madama Butterfly" und analysiert die darin enthaltene Sozialkritik und den Kulturkonflikt. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Thematik in den verschiedenen Fassungen der Oper nachzuvollziehen und die Veränderungen in der Darstellung der Sozialkritik zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- BA Felisa Kowalewski (Autor:in), 2009, Sozialkritik und Kulturkonflikt in Puccinis 'Madama Butterfly', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181961