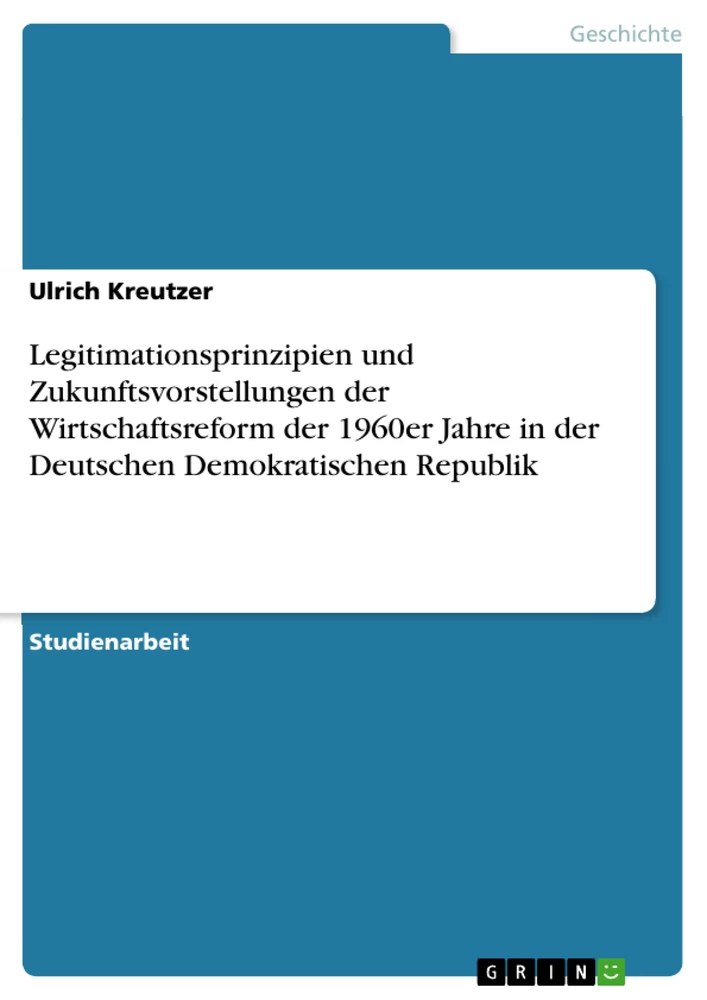Die enge Verflechtung von Politik und Wirtschaft wird am Beispiel der Wirtschaftsreform in der DDR in den 1960er Jahren besonders deutlich. Vorliegendes Buch untersucht einerseits die staatlichen Erwartungen an das umfassende Reformvorhaben sowie die Zukunftsvorstellungen, die man mit den ökonomischen Maßnahmen verband. Andererseits richtet es den Blick auf die Legitimationsprinzipien, nach denen das Reformpaket von staatlicher Seite mit Berechtigung aufgeladen wurde. Dabei wird deutlich, dass die Wirtschaftsreform vordergründig dazu dienen sollte, die ökonomischen Probleme der 1960er Jahre in der DDR zu lösen. Tatsächlich aber galt sie dem SED-Regime auch und insbesondere als Mittel, "den umfassenden Aufbau des Sozialismus zu vollenden".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die widersprüchliche Wirtschaftsreform
- 3. Legitimation und „Zukunft“ durch die Wirtschaftsreform
- 3.1 Bewusstsein der DDR-Führung
- 3.1.1 Verständnis und Notwendigkeit von Legitimation
- 3.1.2 Verständnis von „Zukunft“
- 3.2 Legitimationsprinzipien und Zukunftserwartungen
- 3.2.1 Langfristige Machtsicherung
- 3.2.2 Modernisierung und Revolution in Technik und Wissenschaft
- 3.2.3 Durchsetzung des Sozialismus und internationale Anerkennung
- 3.2.4 Vergleich mit der BRD und Lösung der Deutschlandfrage
- 3.2.5 Verankerung in der geschichtlichen Entwicklung
- 3.2.6 Bruch mit dem Zweiten Weltkrieg und Befriedung der Welt
- 3.1 Bewusstsein der DDR-Führung
- 4. Ergebnisse der Reform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirtschaftsreform der DDR in den 1960er Jahren, indem sie die Legitimationsprinzipien der Reform mit den damit verbundenen Zukunftsvorstellungen der SED-Führung und der Bevölkerung vergleicht. Es wird analysiert, wie die Reform zur Sicherung der Macht der SED und zur Lösung akuter Wirtschaftsprobleme eingesetzt wurde und welche Rolle Zukunftsvisionen dabei spielten.
- Die Legitimation der Wirtschaftsreform durch die SED
- Zukunftserwartungen und -vorstellungen in Bezug auf die Wirtschaftsreform
- Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Zielen und politischen Machtinteressen
- Der Vergleich der DDR-Realität mit den Zielen der Reform
- Die Rolle von Technik und Wissenschaft in den Zukunftsvisionen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Legitimation der Wirtschaftsreform und den damit verbundenen Zukunftserwartungen in der DDR der 1960er Jahre. Sie skizziert den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise.
Kapitel 2 (Die widersprüchliche Wirtschaftsreform): Dieses Kapitel beschreibt die Wirtschaftsreform der DDR, ihre Entstehung, ihren Verlauf und ihr Scheitern im Erreichen der gesteckten Ziele. Es beleuchtet die damit verbundenen Hoffnungen und Erwartungen.
Kapitel 3 (Legitimation und „Zukunft“ durch die Wirtschaftsreform): Der Schwerpunkt der Arbeit liegt hier. Es wird analysiert, wie die SED die Wirtschaftsreform legitimierte und welche Zukunftsvisionen damit verbunden waren. Die Betrachtung umfasst Aspekte wie Machtsicherung, Modernisierung, den internationalen Vergleich und die Verankerung in der geschichtlichen Entwicklung.
Schlüsselwörter
Wirtschaftsreform DDR, SED, Legitimation, Zukunftsvorstellungen, Modernisierung, Sozialismus, Deutschlandfrage, Wirtschaftsgeschichte DDR, 1960er Jahre.
- Quote paper
- Ulrich Kreutzer (Author), 2007, Legitimationsprinzipien und Zukunftsvorstellungen der Wirtschaftsreform der 1960er Jahre in der Deutschen Demokratischen Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181994