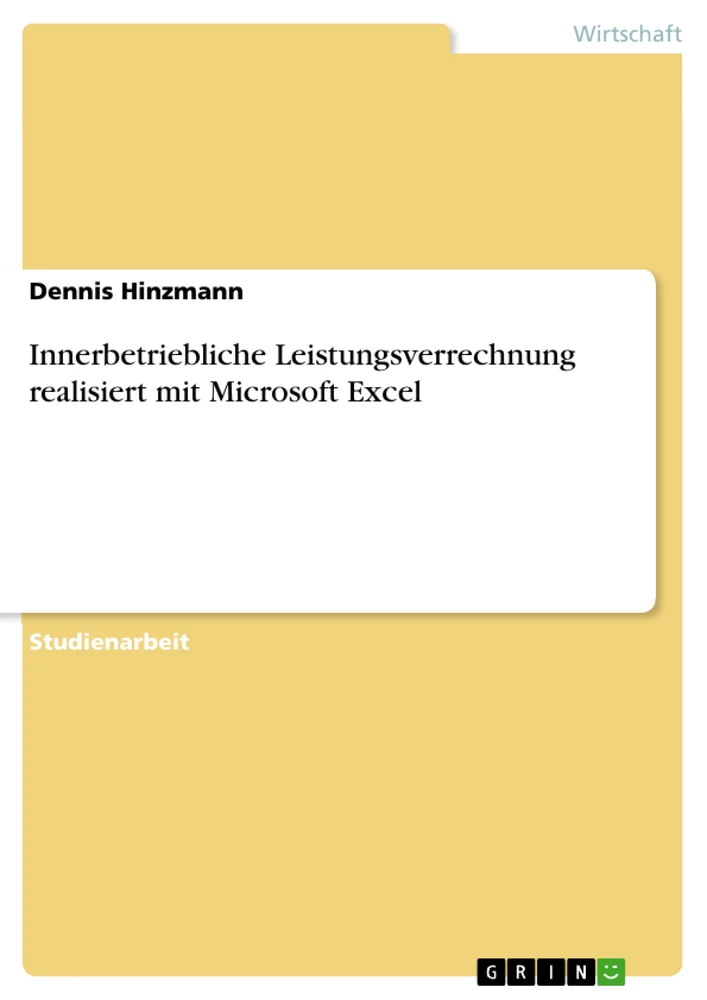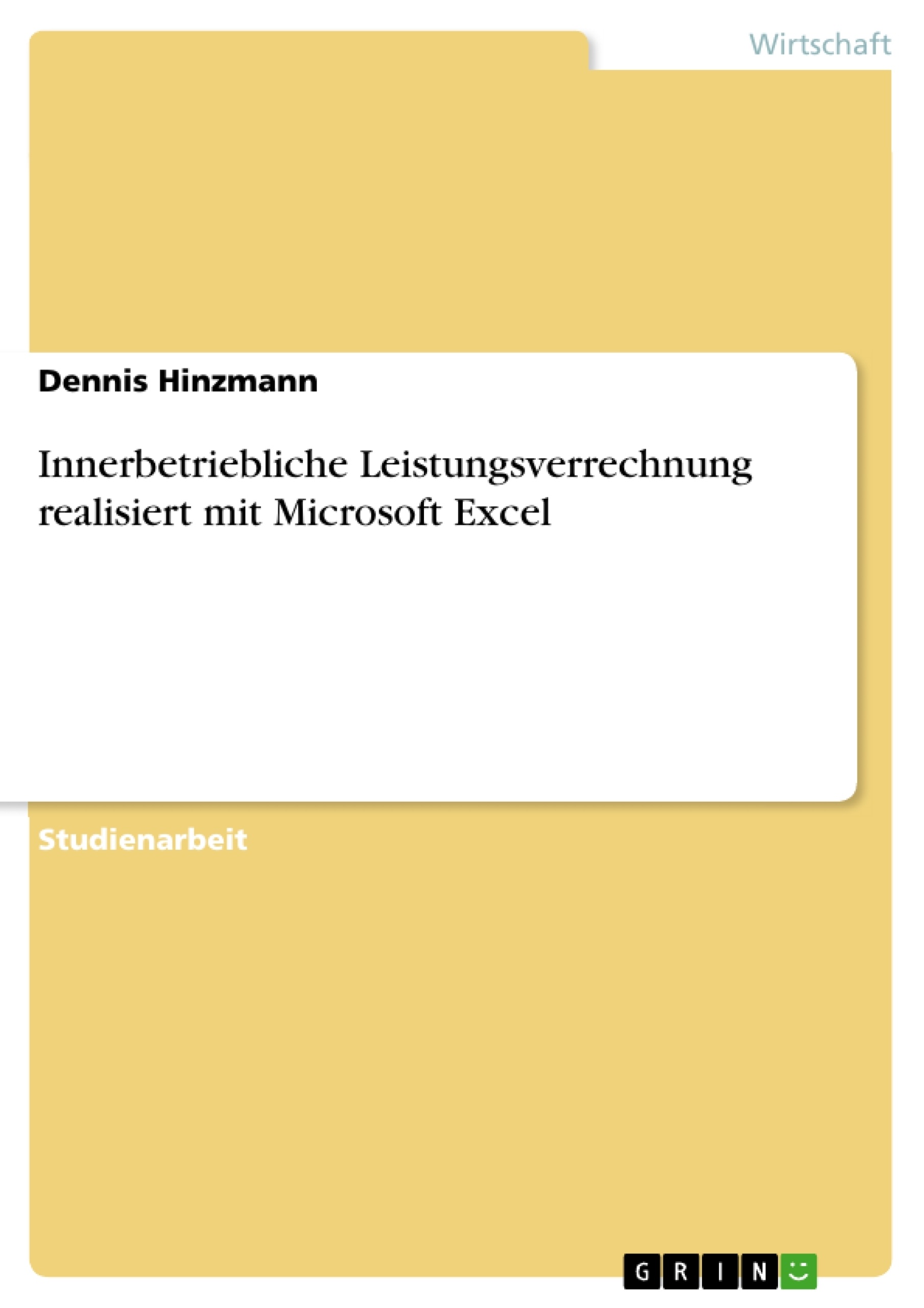Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit einem Teilgebiet der modernen Kostenrechnung, der Verrechnung von sogenannten „Innenaufträgen“. Innenaufträge oder auch „innerbetriebliche Leistungen“ genannt, sind Leistungen, die ein „Teil“ eines Betriebes nicht für den Markt, sondern für einen anderen „Teil“ des Betriebes, z.B. der Fertigung, erbringt. Für die spätere Ermittlung der Selbstkosten der Produkte eines Unternehmens ist es unerlässlich solche Vorleistungen in die Kalkulation mit ein zu beziehen. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung bietet Verfahren, mit deren Hilfe die „Preise“, bzw. die Kosten der o.g. Innenaufträge ermittelt werden können. Somit ist es in erster Linie möglich, die Entscheidung zu treffen ob solch eine selbsterstellte Leistung weiterhin selbst erstellt oder in Zukunft fremdbezogen werden soll und zum anderen wird eine genauere Basis für die Produktkalkulation geschaffen. Um das Problem der richtigen Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen zu lösen, sind in der Literatur verschiedene Verfahren beschrieben. Drei dieser Verfahren werden in dieser Hausarbeit dargestellt. Insbesondere wird mit Beispielen aus der betrieblichen Praxis eines modellhaften Industriebetriebes gearbeitet. Diese werden mit der Software Microsoft Excel exemplarisch umgesetzt. Diese Hausarbeit soll, nach kurzer Einführung, die Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung aufzeigen, mit Microsoft Excel Beispiellösungen vorstellen, Vor- und Nachteile des jeweiligen Verfahrens aufzeigen und zum Ende eine Empfehlung für das genaueste Verfahren abgeben. Gleichzeitig wird gezeigt, dass „kleinere Betriebe“, in denen die Anzahl der Kostenstellen nicht zu hoch ist, durchaus ohne größere Software-Lösungen wie SAP auskommen können, wenn bekannt ist wie man mit Standardsoftware verrechnungstechnische Probleme lösen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung
- Arten
- Aufgaben
- Verfahrensunterscheidung
- Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
- Das Anbauverfahren
- Das Stufenleiterverfahren
- Das simultane Gleichungsverfahren
- Vergleich der verschiedenen Verfahren - Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (IBLV) und stellt verschiedene Verfahren zur Ermittlung der Kosten, die innerhalb eines Unternehmens zwischen verschiedenen Leistungseinheiten umverteilt werden, vor. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Methoden und vergleicht ihre Vor- und Nachteile.
- Arten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
- Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (Anbau-, Stufenleiter-, simultanes Gleichungsverfahren)
- Vergleich der Verfahren und deren Eignung für unterschiedliche Situationen
- Praktische Anwendung der IBLV mit Microsoft Excel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ein und erläutert die Relevanz dieses Themas für Unternehmen.
Kapitel 2 analysiert die verschiedenen Arten der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, beleuchtet deren Aufgaben und stellt verschiedene Verfahren einander gegenüber.
Kapitel 3 widmet sich der detaillierten Analyse der wichtigsten Verfahren der IBLV: dem Anbauverfahren, dem Stufenleiterverfahren und dem simultanen Gleichungsverfahren.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und vergleicht die verschiedenen Verfahren hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
Schlüsselwörter
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Anbauverfahren, Stufenleiterverfahren, simultanes Gleichungsverfahren, Kostenrechnung, Kostenträgerrechnung, Gemeinkosten, Leistungsverflechtung, Verrechnungspreise, Microsoft Excel.
- Citar trabajo
- Dennis Hinzmann (Autor), 2011, Innerbetriebliche Leistungsverrechnung realisiert mit Microsoft Excel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182005