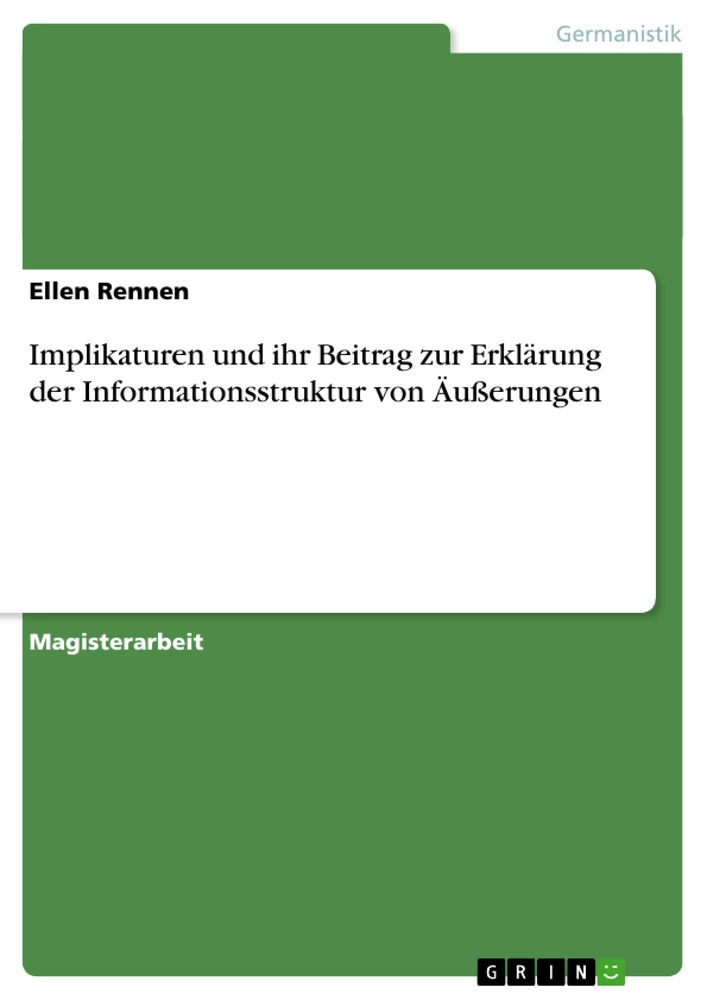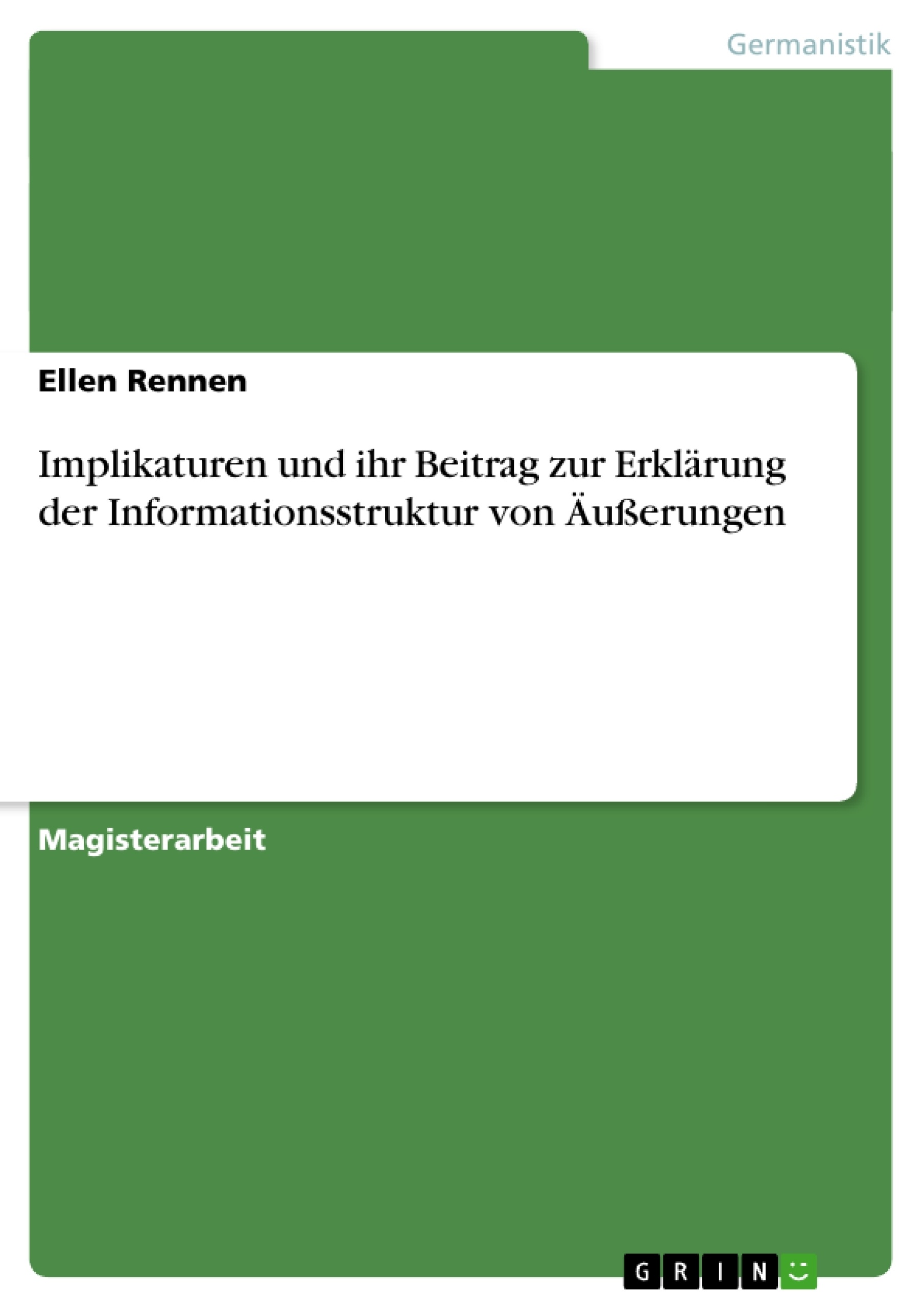[...] Viele Wissenschaftler
beschäftigten sich schon mit diesem Thema und haben eine Vielfalt von Theorien
entwickelt. Aus diesem Grund werde ich mich auf wenige ausgesuchte Modelle
konzentrieren, um den Rahmen dieser Untersuchung einzuhalten.
Grice legt in seinem Kommunikationsmodell verschiedene Kriterien fest, die
innerhalb eines Gespräches beachtet werden sollten. Ist dies nicht der Fall, entstehen
Implikaturen. Sie gestalten die Kommunikation auf einer gesonderten Ebene, die es
vom Adressaten zu verstehen gilt. Bei diesem Prozeß sind die Kommunikationsmaximen
eine wichtige Hilfe. Anschließend werden die Verbesserungen dieser
Theorie durch andere Wissenschaftler kurz erläutert. Dieser kritische Blick erlaubt
eine Überprüfung des Modells hinsichtlich seiner Anwendbarkeit auf die alltägliche
Kommunikation.
Präziser wird die Struktur von Informationen durch die Skalen-Modelle untersucht.
Hier wird der Schwerpunkt auf die verschiedenen kognitiven Status gelegt, die Sprecher und Hörer während eines Gespräches innehaben können. Der Status gibt
Auskunft über die Bedeutung des aktuellen Themas. In der Sprachwissenschaft wird
jedoch über die Anzahl der jeweiligen Status diskutiert. Die Hierarchie des
Bekanntheitsgrades als auch die Vertrautheits-Skala formulieren zwar die gleiche
Anzahl an Status, jedoch bestehen zwischen ihnen kleine Unterschiede.
Nachdem die Modelle vorgestellt wurden, werde ich die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede herausstellen. Auf diese Weise können neue Erkenntnisse gewonnen
werden, wie Informationen gestaltet sein müssen, damit die Kommunikation
erfolgreich verläuft. Dabei ist es sehr hilfreich, daß in dieser Arbeit sowohl ein
allgemeineres Modell als auch spezifische Untersuchungen betrachtet werden. Auf
diese Weise können unterschiedliche Aspekte der Informationsstruktur berücksichtigt
und kritisch betrachtet werden. Den Mittelpunkt bilden hier die Implikaturen.
Zum Schluß der Arbeit werde ich definieren, was genau unter dem Begriff
Informationsstruktur zu verstehen ist. Anhand der so bestimmten Merkmale können
die vorgestellten Modelle gute Ansätze liefern, um die Forschung auf diesem Gebiet
in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Die Begriffe Bezug, Thema, Entität und Referent werden in dieser Arbeit
gleichbedeutend verwendet. Sie bezeichnen den aktuellen Gesprächsgegenstand. Bei
meiner Untersuchung der verschiedenen Modelle schließe ich mich den jeweils dort
verwendeten Begriffe an.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Kommunikationsmodell von Grice
- 1. Begriffsdefinition
- 2. Das Kooperationsprinzip
- 3. Die Maximen
- a) Die Quantitätsmaxime
- b) Die Qualitätsmaxime
- c) Die Relevanzmaxime
- d) Die Modalitätsmaxime
- e) Verletzungen der Maximen
- 4. Implikaturen
- a) Konversationale Implikaturen
- b) Partikularisierte konversationale Implikaturen
- c) Generalisierte konversationale Implikaturen
- d) Konventionale Implikaturen
- e) Skalare Implikaturen
- 5. Grenzen und Kritik von Grices Modell
- a) Das Kooperationsprinzip und die Maximen
- b) Implikaturen
- III. Skalen-Modelle
- 1. Die Hierarchie des Bekanntheitsgrades
- a) Die einzelnen Status
- b) Grenzen und Kritik
- 2. Vertrautheitsskala
- 3. Topik-Kontinuität
- 4. Identifizierbarkeit und Zugänglichkeit
- 5. Zusammenfassung der Skalen-Modelle
- 1. Die Hierarchie des Bekanntheitsgrades
- IV. Zusammenspiel der Skalen-Modelle mit Grices Theorie
- 1. Die Quantitätsmaxime und die Hierarchie des Bekanntheitsgrades
- 2. Vergleich von Implikaturen und Ableitungen
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht, wie Implikaturen die Informationsstruktur von Äußerungen beeinflussen. Ziel ist es, zu zeigen, wie diese Sonderform der Äußerungsbedeutung den Aufbau von Informationen in mündlicher Kommunikation gestaltet und welche Erkenntnisse sie für die Sprachwissenschaft liefern können.
- Das Kommunikationsmodell von Grice und seine Bedeutung für die Implikatur-Theorie
- Die Rolle von Maximen in der Kommunikation und ihre Auswirkungen auf die Informationsstruktur
- Die verschiedenen Arten von Implikaturen und ihre spezifischen Eigenschaften
- Die Skalen-Modelle, die die kognitiven Status von Sprecher und Hörer während eines Gespräches beschreiben
- Die Wechselwirkung zwischen Implikaturen und Skalen-Modellen in Bezug auf die Informationsstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Informationsstruktur in der modernen Informationsflut dar. Sie führt den Begriff der Implikatur ein und skizziert den Fokus der Arbeit, der auf der Untersuchung des Einflusses von Implikaturen auf die Informationsstruktur mündlicher Kommunikation liegt.
Kapitel II stellt das Kommunikationsmodell von Grice vor, das grundlegende Prinzipien und Maximen für eine gelungene Kommunikation definiert. Die Arbeit erläutert die verschiedenen Arten von Implikaturen, die durch Verletzung oder Ausnutzung dieser Maximen entstehen. Zudem werden die Grenzen und die Kritik an Grices Modell diskutiert.
Kapitel III widmet sich den Skalen-Modellen, die die Struktur von Informationen anhand der kognitiven Status von Sprecher und Hörer analysieren. Die Arbeit betrachtet die Hierarchie des Bekanntheitsgrades, die Vertrautheitsskala, die Topik-Kontinuität sowie die Identifizierbarkeit und Zugänglichkeit von Informationen.
Kapitel IV untersucht das Zusammenspiel der Skalen-Modelle mit Grices Theorie, insbesondere die Verbindung zwischen der Quantitätsmaxime und der Hierarchie des Bekanntheitsgrades. Die Arbeit vergleicht die Ergebnisse der Implikatur-Theorie mit den Ableitungen aus den Skalen-Modellen.
Das Kapitel V bietet eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und zeigt, wie Implikaturen die Informationsstruktur von Äußerungen prägen. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz dieser Erkenntnisse für die Sprachwissenschaft und die weitere Forschung auf diesem Gebiet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Implikaturen, Informationsstruktur, Kommunikation, Kooperationsprinzip, Maximen, Skalen-Modelle, Bekanntheitsgrad, Vertrautheit, Topik-Kontinuität, Identifizierbarkeit, Zugänglichkeit und mündliche Kommunikation.
- Arbeit zitieren
- Ellen Rennen (Autor:in), 2003, Implikaturen und ihr Beitrag zur Erklärung der Informationsstruktur von Äußerungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18208