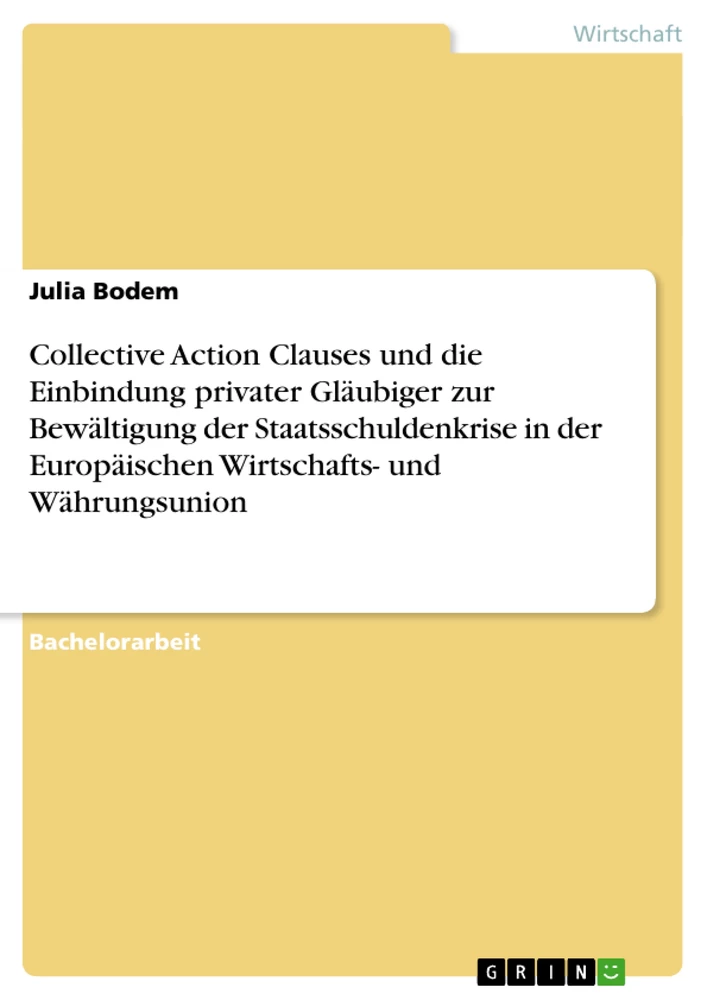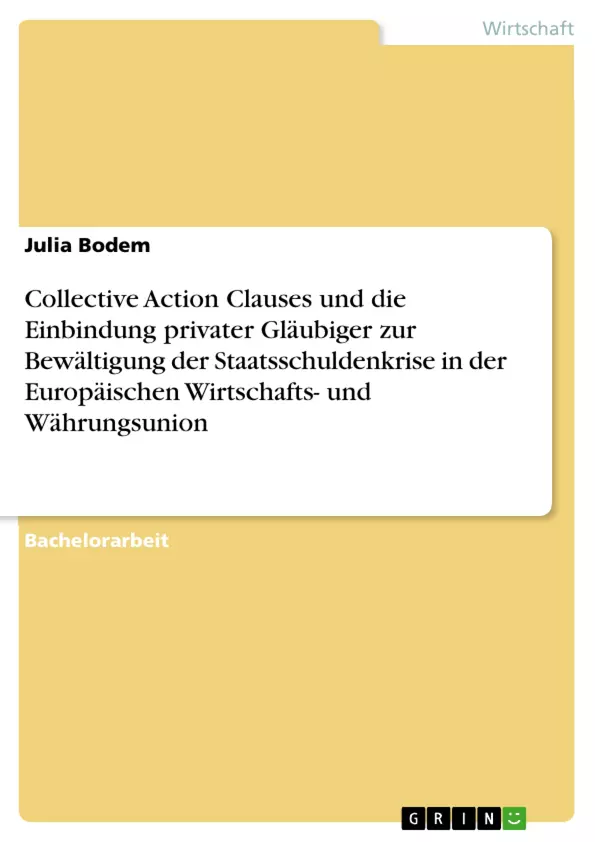„Staaten gehen nicht bankrott.“ Diesen historisch bedeutenden Satz äußerte Walter Wriston, ehemaliger CEO der einstigen Citibank (1967-1984) und zu seiner Zeit einer der mächtigsten Bankiers der Welt, im Jahr 1982. Wenig später gerieten mehrere latein-amerikanische Länder, darunter Argentinien, Brasilien und Mexiko, in eine tiefe Schuldenkrise, welche in der Geschichte deutliche Spuren hinterlassen hat.
Die Vorstellung, ein Staat könne nicht bankrottgehen, wird bis heute kontrovers diskutiert, obschon diese Vorstellung dem traditionellen Völkerrecht entspricht. Die Wirtschaftsgeschichte jedoch kennt zahlreiche Beispiele für Staatsbankrotte aus der Vergangenheit. Das wohl bedeutendste Beispiel stellt der Zahlungsausfall Argentiniens aus dem Jahr 2001/02 über 95 Mrd. USD dar (damals der größte Zahlungsausfall in der Ge-schichte), dessen Folgen bis in die Gegenwart reichen. Es zeigt sich: Staaten können durchaus bankrottgehen.
Schien es bislang allerdings als feste Grundannahme, das Phänomen „Staatsbankrott“ sei ausschließlich für Entwicklungsländer bestimmt, belegen die jüngsten Erfahrungen innerhalb der Eurozone, dass sich diese als nicht haltbar erweist.
Nachdem die neugewählte griechische Regierung im Oktober 2009 das Haushaltsdefizit für das Jahr von 3,7 auf 12,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nach oben revidieren musste, rückte der griechische Haushalt zunehmend in den Fokus der Betrach-tungen von Politik und den internationalen Kapitalmärkten. Zweifel an der Tragfähig-keit des Schuldenstandes ließen die Risikoprämien in den Folgemonaten auf ein noch nie dagewesenes Niveau seit Einführung der Gemeinschaftswährung im Jahre 1999 ansteigen. Am 27. April 2010 rentierten zehnjährige griechische Staatsanleihen trotz
ambitionierter Sparprogramme bei einer Marke von rund 12 Prozent. Zuvor hatte die Ratingagentur Standard & Poor’s Griechenland auf „Ramschstatus“ herabgestuft. Ein Staatsbankrott Griechenlands Anfang Mai 2010 konnte nur durch finanzielle Stüt-zungsmaßnahmen der Euro-Partnerländer in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abgewendet werden.
Der Vertrauensverlust in die Tragfähigkeit des öffentlichen Haushaltes griff zunehmend auf andere europäische Staaten über. Ausgehend von einem drohenden Dominoeffekt und einer damit verbundenen Gefahr für die Stabilität des gesamten Währungsgebietes, beschlossen die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen zum Thema Staatsanleihen
- 2.1 Staatsanleihen
- 2.2 Der Staatsbankrott
- 2.2.1 Definition und Abgrenzung zur Unternehmensinsolvenz
- 2.2.2 Entstehung
- 2.2.3 Historische Betrachtung der Abwicklung
- 3. Einbindung privater Gläubiger in die Bewältigung staatlicher Verschuldungskrisen
- 3.1 Einbindung privater Gläubiger: Überblick ausgewählter Ansätze
- 3.2 Gründe für die Einbindung privater Gläubiger
- 3.3 Probleme bei der Einbindung privater Gläubiger bei der Schuldenrestrukturierung
- 3.3.1 Koordinationsprobleme zwischen den Gläubigern
- 3.3.1.1 Rush to the Exit
- 3.3.1.2 Rush to the Court House
- 3.3.1.3 Freerider- / Holdout-Problem
- 3.3.2 Koordinationsproblem zwischen Gläubigern und Schuldner
- 4. Collective Action Clauses
- 4.1 Majority Action Clause
- 4.2 Majority Enforcement Provision / Non-Acceleration Clause
- 4.3 Collective Representation Clause
- 4.4 Sharing Clause
- 4.5 Initiation Clause
- 4.6 Aggregation Clause
- 4.7 Bewertung der Collective Action Clauses
- 4.8 Verwendung und Verbreitung von Collective Action Clauses
- 4.9 Collective Action Clauses in der bisherigen Praxis staatlicher Umschuldungen
- 5. Die Staatsschuldenkrise in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
- 5.1 Der Weg in die Krise
- 5.2 Entwicklungen im Zuge der Finanzmarktkrise
- 5.3 Der Weg aus der Krise - Quo vadis?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Collective Action Clauses (CACs) bei der Bewältigung von Staatsschuldenkrisen, insbesondere im Kontext der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU). Ziel ist es, die Funktionsweise von CACs zu analysieren und deren Bedeutung für die Einbindung privater Gläubiger in Schuldenrestrukturierungen zu bewerten.
- Analyse der Funktionsweise von Collective Action Clauses
- Bedeutung von CACs für die Einbindung privater Gläubiger
- Probleme bei der Koordination von Gläubigern in Staatsschuldenkrisen
- Der Einfluss von CACs auf die Bewältigung von Staatsschuldenkrisen in der EWWU
- Bewertung verschiedener Ansätze zur Einbindung privater Gläubiger
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 erläutert grundlegende Aspekte von Staatsanleihen und Staatsbankrotten. Kapitel 3 befasst sich mit der Einbindung privater Gläubiger in die Bewältigung staatlicher Verschuldungskrisen und analysiert verschiedene Ansätze sowie die damit verbundenen Probleme. Kapitel 4 untersucht detailliert die verschiedenen Arten von Collective Action Clauses und deren praktische Anwendung. Kapitel 5 beleuchtet die Staatsschuldenkrise in der EWWU, ihre Ursachen und die bisherigen Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Collective Action Clauses, Staatsschuldenkrisen, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), private Gläubiger, Schuldenrestrukturierung, Koordinationsprobleme, Staatsbankrott, Finanzmarktkrise.
- Quote paper
- Julia Bodem (Author), 2011, Collective Action Clauses und die Einbindung privater Gläubiger zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182105