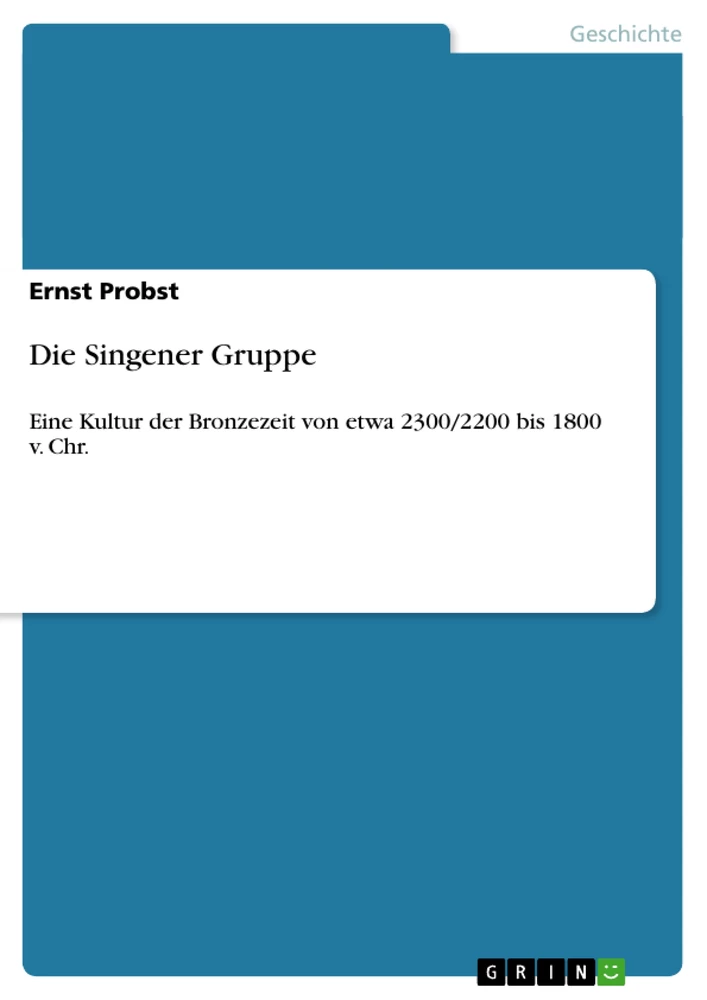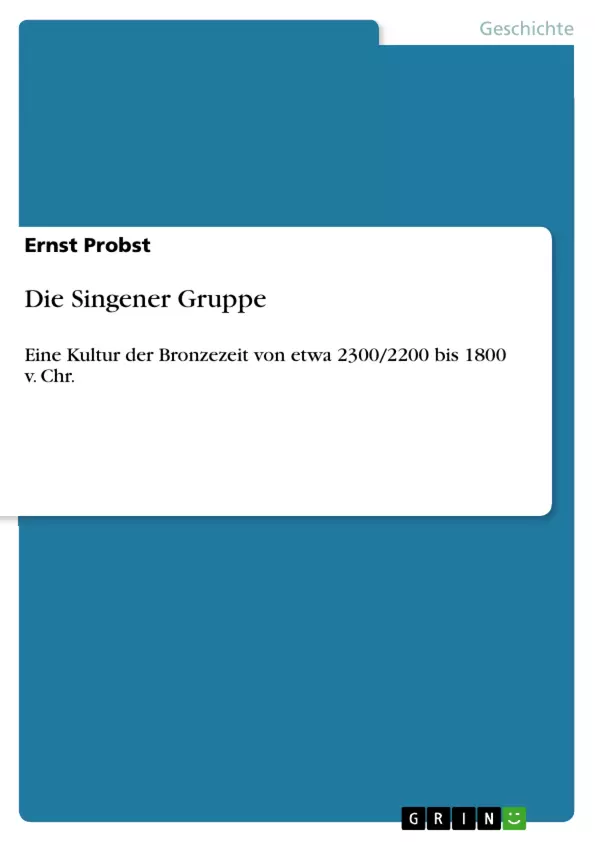Eine Kultur, die in der Frühbronzezeit von etwa 2300/2200 bis 1800 v. Chr. gebietsweise in Baden-Württemberg existierte, steht im Mittelpunkt des Taschenbuches »Die Singener Gruppe«. Geschildert werden die Anatomie und Krankheiten der damaligen Ackerbauern und Viehzüchter, ihre Siedlungen, ihr Schmuck, ihre Waffen, ihr Handel und ihre Religion. Verfasser dieses Taschenbuches ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst. Er hat sich vor allem durch seine Werke »Deutschland in der Urzeit« (1986), »Deutschland in der Steinzeit« (1991) und »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) einen Namen gemacht. Das Taschenbuch »Die Singener Gruppe« ist Dr., Gretel Gallay, Professor Dr. Hans-Eckart Joachim, Professor Dr. Horst Keiling, Professor Dr. Rüdiger Krause, Dr. Friedrich Laux und Dr. Peter Schröter gewidmet, die den Autor mit Rat und Tat bei seinen Recherchen über Kulturen der Frühbronzezeit unterstützt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Die Singener Gruppe
- Eine Kultur der Bronzezeit von etwa 2300/2200 bis 1800 v. Chr.
- Widmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buchfragment befasst sich mit der Singener Gruppe, einer Kultur der Bronzezeit in Deutschland. Es zielt darauf ab, einen Einblick in diese Kultur zu geben und die wissenschaftliche Forschung, die zu ihrem Verständnis beigetragen hat, zu würdigen.
- Die Singener Gruppe als Kultur der Bronzezeit
- Die Zeitliche Einordnung (ca. 2300/2200 bis 1800 v. Chr.)
- Die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung
- Anerkennung der beteiligten Wissenschaftler
Zusammenfassung der Kapitel
Das vorliegende Fragment enthält eine Widmung an Wissenschaftler, die bei der Erforschung der Frühbronzezeit in Deutschland behilflich waren, sowie Informationen zur Singener Gruppe, ihrer Zeitlichen Einordnung und ihrer Bedeutung als Bronzezeitkultur.
Schlüsselwörter
Singener Gruppe, Bronzezeit, Frühbronzezeit, Deutschland, Archäologie, Wissenschaft, Forschung.
- Citation du texte
- Ernst Probst (Auteur), 2011, Die Singener Gruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182198