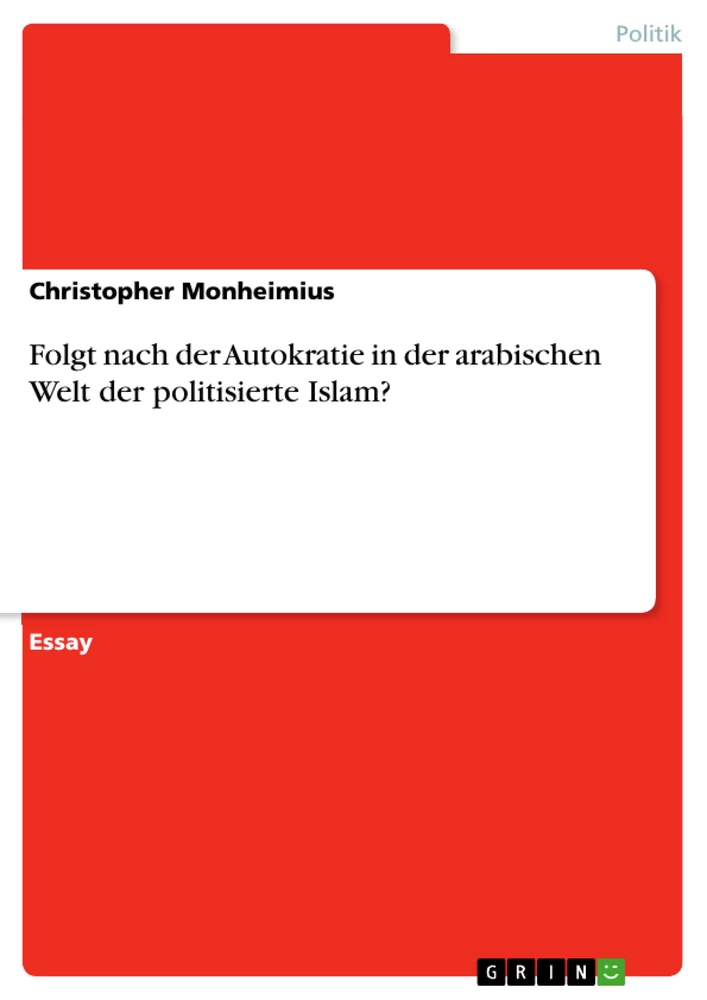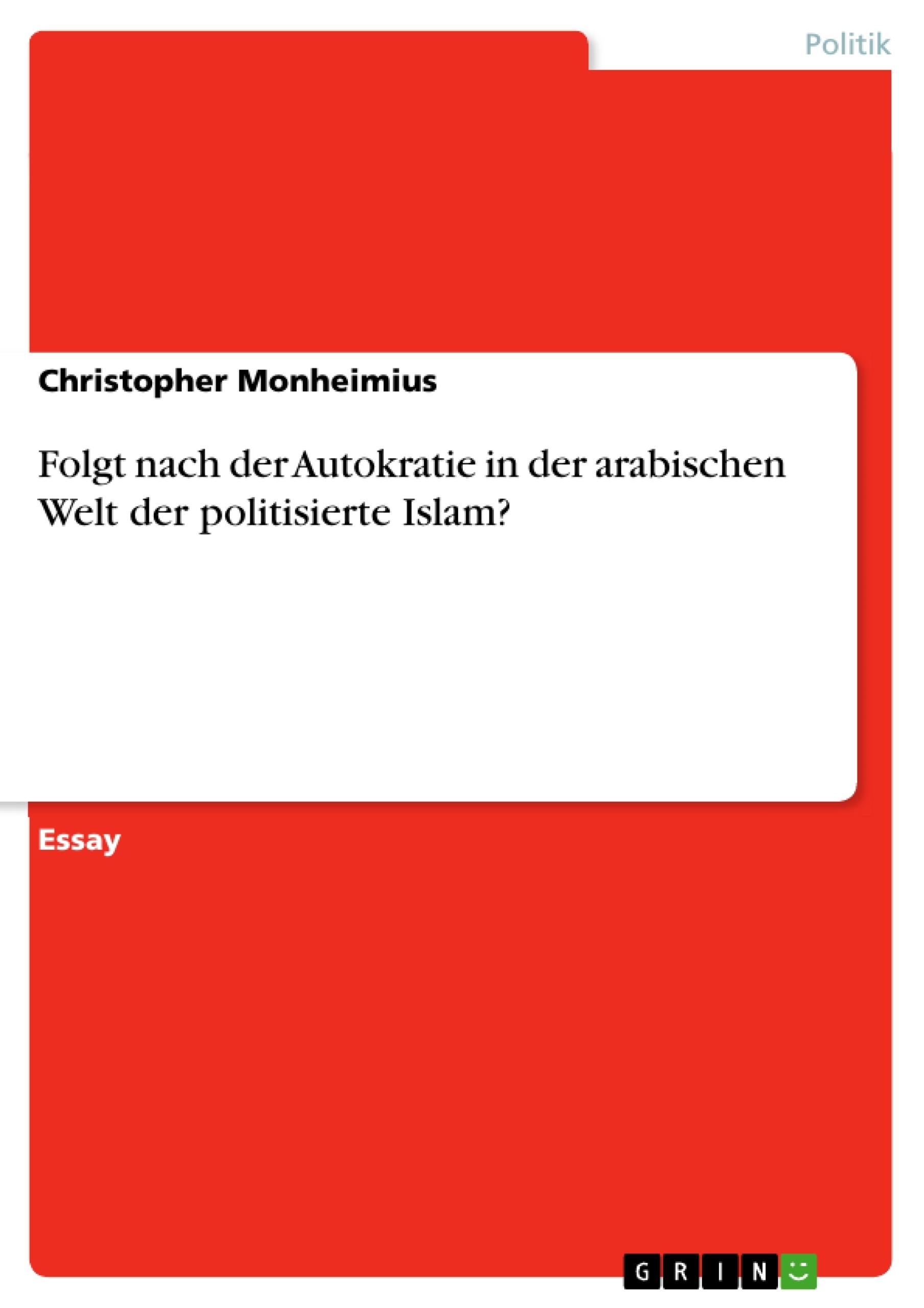Nach 23-jähriger Amtszeit konnte der tunesische Staatspräsident und Vorsitzende der dominierenden Partei Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), Zine el-Abidine Ben Ali, die aufkommenden Protestbewegungen gegen seine Person und das mit ihm verbundene politische System nicht unterbinden. Sein autokratischer Führungsstil, der undurchschaubare staatliche Nepotismus, seine selbst verliehenen Prärogative und die sozioökonomische Misswirtschaft trieben die Menschen auf die Straßen, um gegen das autokratische System zu demonstrieren. Ben Alis Äußerung, bei den anstehenden Parlamentswahlen 2014 „nicht noch einmal zu kandidieren“,1 verpuffte ungehört in der aufgeheizten Atmosphäre des Maghreb-Staates. Nach anhaltenden Protesten und Unruhen, die sich über das gesamte Land erstreckten, floh Ben Ali aus Tunesien.2
Der Wunsch nach universell gültigen Menschenrechte, der Partizipation am politischen System und der Selbstbestimmung über das eigene Leben schwappte auch auf weitere Staaten des Maghreb, des Maschrek und des Nahen sowie Mittleren Ostens über. Ein Nachahmungseffekt mit ungeahntem Ausgang für die regionale politische Stabilität.
Nach 23-jähriger Amtszeit konnte der tunesische Staatspräsident und Vorsitzende der dominierenden Partei Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), Zine el-Abidine Ben Ali, die aufkommenden Protestbewegungen gegen seine Person und das mit ihm verbundene politische System nicht unterbinden. Sein autokratischer Führungsstil, der undurchschaubare staatliche Nepotismus, seine selbst verliehenen Prärogative und die sozioökonomische Misswirtschaft trieben die Menschen auf die Straßen, um gegen das autokratische System zu demonstrieren. Ben Alis Äußerung, bei den anstehenden Parlamentswahlen 2014 ͣnicht noch einmal zu kandidieren“,1 verpuffte ungehört in der aufgeheizten Atmosphäre des Maghreb-Staates. Nach anhaltenden Protesten und Unruhen, die sich über das gesamte Land erstreckten, floh Ben Ali aus Tunesien.2
Der Wunsch nach universell gültigen Menschenrechte, der Partizipation am politischen System und der Selbstbestimmung über das eigene Leben schwappte auch auf weitere Staaten des Maghreb, des Maschrek und des Nahen sowie Mittleren Ostens über. Ein Nachahmungseffekt mit ungeahntem Ausgang für die regionale politische Stabilität.
Fast zeitgleich zu den Unruhen in Tunesien zogen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo Frauen und Männer auf den Innenstadtplatz Tahrir. Die Wut und Unzufriedenheit über das politische System in Ägypten und auf den seit über 29 Jahren amtierenden Ministerpräsidenten Husni Mubarak kanalisierte sich in Massenproteste. Der lokal begonnene Protest weitete sich insbesondere durch internetbasierte soziale Netzwerke (Facebook, Twitter etc.) und einer nationalen und internationalen Berichterstattung zu einer Massenbewegung aus, an deren Ende der Rücktritt von Mubarak stand. Der Sturz des tunesischen und ägyptischen Machthabers löste eine Schallwelle aus mit einem kaum vorstellbaren Nachklang im arabischen Raum. Nach blutigen und verlustreichen Kämpfen ergriffen knapp sechs Monate später libysche revolutionäre Kräfte den einstigen afrikanischen ͣKing of kings“,3 Muammar al Gaddafi, und lynchten ihn in der aufgeheizten Stimmung.
Dipl.-Soz.-Wiss. Christopher Monheimius
Auch das Versprechen einzelner arabischer Machthaber politische Reformen oder Maßnahmen zur Linderung der bestehenden sozioökonomischen Probleme durchführen zu wollen, entpuppen sich als leere Worthülsen. Stattdessen wurde der wiederholte Versuch unternommen, durch Ankündigungen von punktuellen politischen Reformen den eigenen sakrosankten Führungsanspruch zu legitimieren. Das politische System vieler arabischer Staaten kennzeichnet sich durch ͣinformelle, stark personalisierte und damit extrem hierarchische und autoritär geprägte Entscheidungsstrukturen“.4 Die Absicht, genuin politische Reformen zu implementieren, sind kaum bis nicht zu erkennen. Deshalb spricht Nazih Ayubi bereits 1995 von „fierce“ arabischen Staaten, die, um sich zu erhalten, auf Zwangsmaßnahmen gegen die eigene Bevölkerung zurückgreifen.5 Eine Teilhabe der Gesellschaft an politischen und/oder sozioökonomischen Entwicklungen findet nicht statt. Stattdessen werden teilweise ͣ(͙) parts of society and the economy ‘from the outside’ *adaptiert+, without penetrating the society at large”.6 Als Reaktion auf den gesellschaftlichen Ausschluss wird auf der innenpolitischen Ebene der Ausbau des militärischen und geheimdienstlichen Sektors forciert. Dies stärkt einerseits den persönlichen Führungsanspruch des Machthabers nach innen und außen. Andererseits wurde der Versuch unternommen, über Allokationen, Bildungs- und wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen prima facie die Bevölkerung in einem Umfang zu mobilisieren, dass eine Identifikation mit dem Regime gefördert wird. Das Aufkommen von zum Beispiel wirtschaftlichen Krisen führt zu einer Belastungsprobe für das autokratischen System, da die verteilbaren Renten nicht mehr in vollem Maße der Bevölkerung zugeführt werden können. Wohlfahrtsstaatliches Handeln wird erheblich eingeschränkt und es entsteht ein soziales Verteilungsvakuum.7 Um dieses Vakuum zu paralysieren, reagieren arabische Regime sehr unterschiedlich. Durch Repression wollen die herrschenden Eliten eine Perpetuierung des Regimes erzwingen und aufkommende Proteste bereits im Ansatz ersticken. Abgesehen von Gewaltanwendungen sollen durch Kooptationsmaßnahmen und einer begrenzten Wirtschaftsliberalisierung neue Legitimitätsformen geschaffen werden, die aber nur bedingt erfolgreich sind.8
Es bleibt festzuhalten, dass sich in der arabischen Welt Prozesse und Dynamiken in Gang gesetzt haben, deren Ziele weder eine Demokratie, noch die Implementierung einer sozialen Marktwirtschaft waren und sind.
[...]
1 FAZ, 2011: Präsident Ben Ali. Listenreich, gewieft - ins Wanken geraten, 14.01.2011, URL:
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~EE7A1D2BA76B84D6698950918DE5 90852~ATpl~Ecommon~Scontent.html [Download 28.04.2011].
2 l Jazeera, 2011: Tunisia’s Ben Ali flees amid unrest, 15.01.2011, URL:
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/01/20111153616298850.html [Download 28.04.2011].
3 Reuters Africa, 2011: Libyan neighbours hope for new start post-Gaddafi, 21.10.2011, URL: http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE79K2MW20111021 [Download 24.10.2011].
4 Mattes, Hanspeter, 2008: We’re in the rab World, man. Forget democracy, in: GIG Focus Nahost, Nummer 8, S. 2.
5 Ayubi, Nazih N., 1995: Overstating the Arab State, S. 3.
6 Ebd. S. 448.
7 Vgl. Harders, Cilja, 2008: Autoritarismus von unten: Lokale Politik in Ägypten, in: GIGA Focus Nahost, Nummer 12, S. 2.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Der Text analysiert die aufkommenden Protestbewegungen in Tunesien, Ägypten und Libyen, die zum Sturz der jeweiligen Machthaber führten. Er untersucht die Ursachen dieser Bewegungen, wie autokratischer Führungsstil, Nepotismus, sozioökonomische Misswirtschaft und der Wunsch nach Menschenrechten und politischer Partizipation. Der Text beleuchtet auch die Reaktion anderer arabischer Staaten auf diese Ereignisse und die Versuche, durch Reformankündigungen oder Repression die eigene Macht zu erhalten.
Welche Rolle spielten soziale Medien bei den Protesten?
Der Text hebt hervor, dass internetbasierte soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter eine wichtige Rolle bei der Organisation und Verbreitung der Proteste spielten, insbesondere in Ägypten. Sie ermöglichten es, die Proteste schnell zu einer Massenbewegung zu erweitern und sowohl national als auch international zu berichten.
Was waren die Gründe für die Unzufriedenheit in Tunesien?
In Tunesien führten der autokratische Führungsstil von Präsident Ben Ali, staatlicher Nepotismus, seine selbst verliehenen Prärogative und die sozioökonomische Misswirtschaft zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung und trieben sie auf die Straßen, um gegen das Regime zu demonstrieren.
Wie reagierten andere arabische Staaten auf die Ereignisse?
Einige arabische Machthaber versuchten, durch Ankündigungen von politischen Reformen oder Maßnahmen zur Linderung sozioökonomischer Probleme die Bevölkerung zu beruhigen. Der Text argumentiert jedoch, dass diese Ankündigungen oft leere Worthülsen waren und dazu dienten, den eigenen Führungsanspruch zu legitimieren. Stattdessen wurde oft auf Repression und den Ausbau des militärischen und geheimdienstlichen Sektors gesetzt.
Welche Schlüsse zieht der Autor?
Der Autor schlussfolgert, dass die Prozesse und Dynamiken in der arabischen Welt nicht zwangsläufig auf eine Demokratie oder eine soziale Marktwirtschaft abzielen. Er betont, dass die Ziele der Bewegungen vielfältig sind und die Situation komplex ist.
Wer ist Christopher Monheimius?
Christopher Monheimius ist ein Dipl.-Soz.-Wiss. (Diplom-Sozialwissenschaftler), der diesen Text verfasst hat.
Welche Quellen werden im Text zitiert?
Der Text zitiert Artikel aus FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Al Jazeera, Reuters Africa und GIGA Focus Nahost. Es werden auch die Werke von Hanspeter Mattes und Nazih N. Ayubi zitiert.
- Arbeit zitieren
- Christopher Monheimius (Autor:in), 2011, Folgt nach der Autokratie in der arabischen Welt der politisierte Islam?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182254