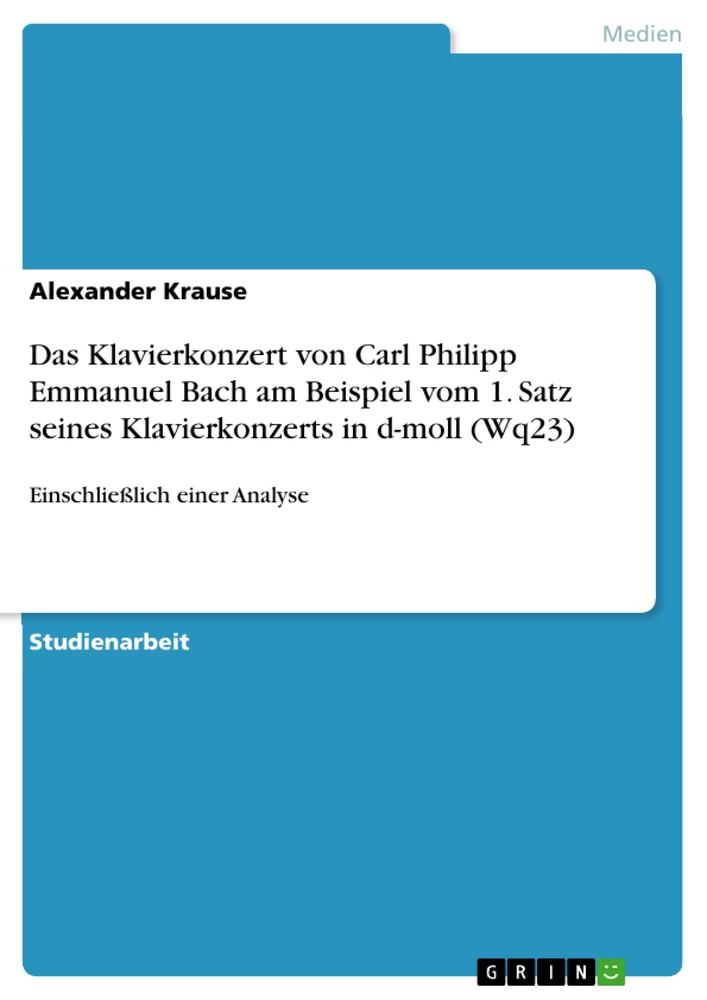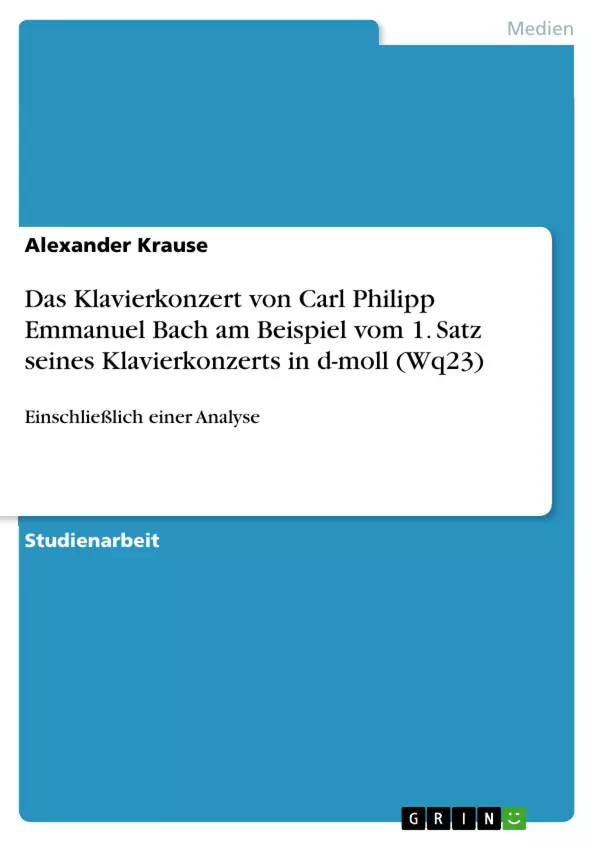Die vorliegende Hausarbeit reflektiert das Klavierkonzert von Carl Philipp Emanuel Bach
(CPE) im Kontext einer allgemeinen Entwicklungsgeschichte.
Die Epoche zwischen Johann Sebastian Bach (Bach) und Wolfgang Amadeus Mozart in den
Jahren. von 1730 bis ca. 1770 steht für die Ausprägung einer eigenen Tonsprache, die von der
Durchdringung der polyphonen Setzweise des Nordens und der homophonen des Südens
geprägt ist. Die Sonatenhauptsatzform (SHF) verdrängt zusehends die Vivaldische
Konzertform, um schließlich das vorherrschende Kompositionsprinzip der Klassik zu werden.
Das Cembalo wandelt sich zeitgleich vom begleitenden Generalbassinstrument zum
solistischen Konzertinstrument und wird zum populärsten des 18. Jahrhunderts, besonders im
Solokonzert. Dazu verlässt das Konzert den elitären Rahmen von Hof und Kirche und bedient
die Forderung des entstehenden Bürgertums nach musikalischer Rezeption und Betätigung.
Die vorliegende Arbeit bietet eine kurze einleitende Geschichtsschreibung zum
Konzert bzw. zum Klavierkonzert, womit zu einem Grundverständnis beigetragen wird. Wenige biografische
Details und eine kleine Systematisierung des Klavierkonzertschaffens von Carl Philipp Emmanuel Bach (CPE) schließen sich an.
Die Analyse des 1. Satzes des Konzerts in d-moll bereitet schließlich auch darauf vor, typische Entwicklungen in seiner
Kompositionsweise zu reflektieren, insbesondere im Hinblick auf die Ausformulierung der
Sonatenhauptsatzform im Konzert. Entgegen verallgemeinernder Hypothesen über einen möglichen Einfluss
von CPE auf die Wiener Trias scheint diese Herangehensweise insofern angemessen, da sie
am eigentlichen Werk bleibt. Die Frage nach dem Einfluss des Schaffens von CPE auf die
nachfolgende Klassik wird durch biografische Zeugnisse bzw. historische Fakten
abgeschlossen.
Die Analyse zeigt weiterhin individuelle Abweichungen dieses Konzerts von der tradierten Ritornellform von Vivaldi. Von besonderem Interesse ist hier die kompositorische Realisierung einer ausgesprochenen Reprisenidee. In diesem Zuge wird versucht, die Ritornellform, als das (noch) dominierende Kompositionsprinzip, mit der(konkurrierenden)Sonatenhauptsatzform (der Wiender Klassik) in Beziehung zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Konzert
- Carl Philipp Emmanuel Bach
- Analyse des 1. Satzes des Klavierkonzerts in d-moll (Wq 23)
- Interpretation der kompositorischen Merkmale des analysierten Konzertsatzes, insbesondere unter dem Aspekt Ritornellform vs. Sonatenhauptsatzform
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Klavierkonzert von Carl Philipp Emanuel Bach im Kontext der musikalischen Entwicklung zwischen Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Ziel ist es, das Werk im Lichte seiner Zeit zu betrachten und seine Eigenständigkeit gegenüber der späteren Wiener Klassik herauszustellen. Die Arbeit vermeidet anachronistische Bewertungen und konzentriert sich auf die Analyse des ersten Satzes von CPE Bachs Klavierkonzert in d-moll (Wq 23).
- Entwicklung des Klavierkonzerts im 18. Jahrhundert
- Stilistische Merkmale der Musik CPE Bachs
- Analyse der Sonatenhauptsatzform im Kontext des Werkes
- Der Einfluss des galanten Stils
- Bewertung der Musik CPE Bachs abseits der Wiener Klassik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die musikalische Epoche zwischen J.S. Bach und Mozart als geprägt von der Synthese polyphoner und homophoner Stile. Sie diskutiert die Verdrängung der Vivaldischen Konzertform durch die Sonatenhauptsatzform und den Wandel des Cembalos vom Generalbass- zum Soloinstrument. Die Arbeit problematisiert die Tendenz, die Musik dieser Zeit anhand der Wiener Klassik zu bewerten und betont die Notwendigkeit einer eigenständigen Betrachtungsweise, die die Vielfältigkeit und Eigenheiten der "Frühklassik" würdigt. Die Einleitung stellt CPE Bach in den Mittelpunkt der Untersuchung und kündigt die Analyse seines Klavierkonzerts Wq 23 an.
Zum Konzert: Dieses Kapitel beleuchtet den vielschichtigen Begriff "Konzert" in seiner historischen Entwicklung. Es zitiert Mattheson und Prätorius um die unterschiedlichen Bedeutungen und die etymologische Herkunft des Wortes zu verdeutlichen – vom "Wetteifern" zum "Zusammenwirken". Das Kapitel verfolgt die semantische Wandlung des Begriffs und verweist auf die Entwicklung des Concerto grosso als frühe Form des Instrumentalkonzerts. Die Ausführungen betonen die Ambivalenz im Wesen des musikalischen Konzertierens, als antiphonales Mit- und Gegeneinander.
Schlüsselwörter
Carl Philipp Emanuel Bach, Klavierkonzert, Sonatenhauptsatzform, Galanter Stil, Frühklassik, d-moll Konzert (Wq 23), Wiener Klassik, Konzertform, historische Musikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Hausarbeit: Analyse des Klavierkonzerts in d-moll von Carl Philipp Emanuel Bach
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert das Klavierkonzert in d-moll (Wq 23) von Carl Philipp Emanuel Bach. Sie untersucht das Werk im Kontext der musikalischen Entwicklung zwischen Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart, betont seine Eigenständigkeit gegenüber der Wiener Klassik und vermeidet anachronistische Bewertungen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Klavierkonzerts im 18. Jahrhundert, die stilistischen Merkmale der Musik CPE Bachs, die Analyse der Sonatenhauptsatzform im Werk, den Einfluss des galanten Stils und die Bewertung der Musik CPE Bachs außerhalb des Kontextes der Wiener Klassik. Die Hausarbeit beleuchtet auch den Begriff "Konzert" in seiner historischen Entwicklung und die Ambivalenz des musikalischen Konzertierens.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zum Konzert, Carl Philipp Emanuel Bach, Analyse des 1. Satzes des Klavierkonzerts in d-moll (Wq 23), Interpretation der kompositorischen Merkmale des analysierten Konzertsatzes, insbesondere unter dem Aspekt Ritornellform vs. Sonatenhauptsatzform, und Schlusswort.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist es, das Klavierkonzert von CPE Bach im Lichte seiner Zeit zu betrachten und seine Eigenständigkeit gegenüber der späteren Wiener Klassik herauszustellen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des ersten Satzes und will eine eigenständige Betrachtungsweise der "Frühklassik" ermöglichen, die die Vielfältigkeit und Eigenheiten dieser Epoche würdigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Carl Philipp Emanuel Bach, Klavierkonzert, Sonatenhauptsatzform, Galanter Stil, Frühklassik, d-moll Konzert (Wq 23), Wiener Klassik, Konzertform, historische Musikwissenschaft.
Wie wird die Musik von CPE Bach in der Hausarbeit bewertet?
Die Hausarbeit vermeidet anachronistische Bewertungen der Musik CPE Bachs im Lichte der Wiener Klassik und konzentriert sich auf eine eigenständige Betrachtung, die die Spezifika der "Frühklassik" berücksichtigt. Sie betont die Synthese polyphoner und homophoner Stile in dieser Epoche und den Wandel der Konzertform.
Welche Rolle spielt die Sonatenhauptsatzform in der Hausarbeit?
Die Sonatenhauptsatzform ist ein zentrales Thema der Analyse des ersten Satzes des Klavierkonzerts. Der Vergleich mit der Ritornellform spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Verständnis der kompositorischen Merkmale des Werkes.
Wie wird der Begriff "Konzert" in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit beleuchtet den Begriff "Konzert" in seiner historischen Entwicklung, von seiner etymologischen Herkunft bis hin zur Entwicklung des Concerto grosso und dem Wandel des Cembalos vom Generalbass- zum Soloinstrument. Sie betont die Ambivalenz des musikalischen Konzertierens als antiphonales Mit- und Gegeneinander.
- Arbeit zitieren
- Alexander Krause (Autor:in), 2009, Das Klavierkonzert von Carl Philipp Emmanuel Bach am Beispiel vom 1. Satz seines Klavierkonzerts in d-moll (Wq23), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182322