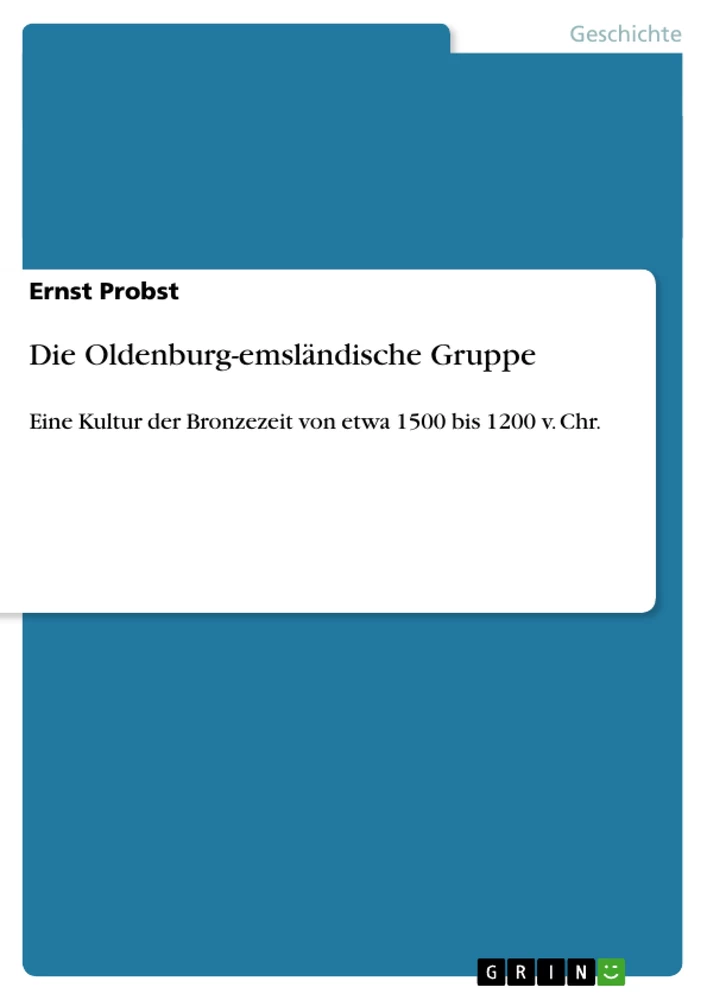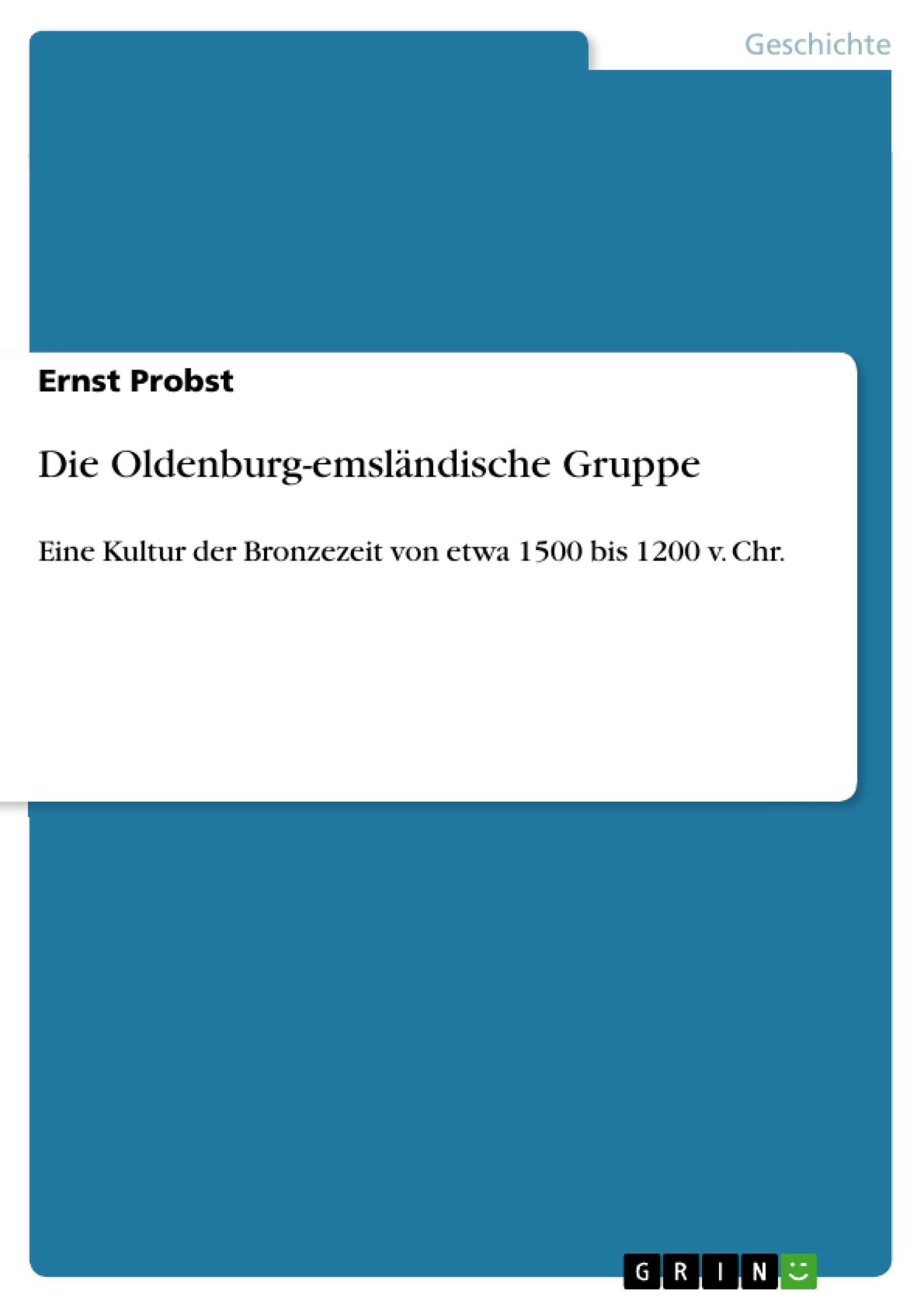Eine Kulturstufe, die in der Bronzezeit von etwa 1500 bis 1200 v. Chr. im westlichen Niedersachsen in den Kreisen Oldenburg, Cloppenburg, Diepholz und Emsland existierte, steht im Mittelpunkt des Taschenbuches »Die Oldenburg-emsländische Gruppe«. Geschildert werden die Kleidung, der Schmuck, die Keramik, Werkzeuge, Waffen, Haustiere, Jagdtiere, das Verkehrswesen, der Handel, die Kunstwerke und die Religion der damaligen Ackerbauern, Viehzüchter und Bronzegießer. Verfasser dieses Taschenbuches ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst. Er hat sich vor allem durch seine Werke »Deutschland in der Urzeit« (1986), »Deutschland in der Steinzeit« (1991) und »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) einen Namen gemacht. Das Taschenbuch »Die Oldenburg-emsländische Gruppe« ist Dr. Friedrich Laux und Dr. Otto Mathias Wilbertz gewidmet, die den Autor bei seinen Recherchen über Kulturen der Bronzezeit in Niedersachsen für sein Buch »Deutschland in der Bronzezeit« unterstützt haben. Es enthält Lebensbilder der wissenschaftlichen Graphikerin Friederike Hilscher-Ehlert aus Königswinter.
Inhaltsverzeichnis
- Die Oldenburg-emsländische Gruppe
- Eine Kultur der Bronzezeit
- von etwa 1500 bis 1200 v. Chr.
- Widmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Oldenburg-emsländischen Gruppe, einer Kultur der Bronzezeit in Niedersachsen, die von etwa 1500 bis 1200 v. Chr. existierte. Der Autor beleuchtet die charakteristischen Merkmale dieser Kultur, ihre Entwicklung und ihren Einfluss auf die Region.
- Die materiellen Hinterlassenschaften der Oldenburg-emsländischen Gruppe
- Die soziale Organisation und die Lebensweise der Menschen
- Die Beziehungen zu anderen Kulturen der Bronzezeit
- Die Bedeutung der Oldenburg-emsländischen Gruppe für die Geschichte Niedersachsens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Entstehung und Entwicklung der Oldenburg-emsländischen Gruppe. Der Autor beschreibt die geografischen und klimatischen Bedingungen der Region, die die Kultur prägten, und analysiert die archäologischen Funde, die Aufschluss über die Lebensweise der Menschen geben. Im zweiten Kapitel werden die materiellen Hinterlassenschaften der Oldenburg-emsländischen Gruppe im Detail beleuchtet. Der Autor stellt die charakteristischen Merkmale der Keramik, der Metallverarbeitung und der Bestattungssitten vor und zeigt die Unterschiede zu anderen Kulturen der Bronzezeit auf. Das dritte Kapitel befasst sich mit der sozialen Organisation und der Lebensweise der Menschen in der Oldenburg-emsländischen Gruppe. Der Autor analysiert die Siedlungsstrukturen, die Wirtschaftsformen und die sozialen Beziehungen, um ein umfassendes Bild der Kultur zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Oldenburg-emsländische Gruppe, die Bronzezeit, Niedersachsen, Archäologie, Kulturgeschichte, Materielle Kultur, Soziale Organisation, Lebensweise, Beziehungen zu anderen Kulturen.
- Citar trabajo
- Ernst Probst (Autor), 2011, Die Oldenburg-emsländische Gruppe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182456