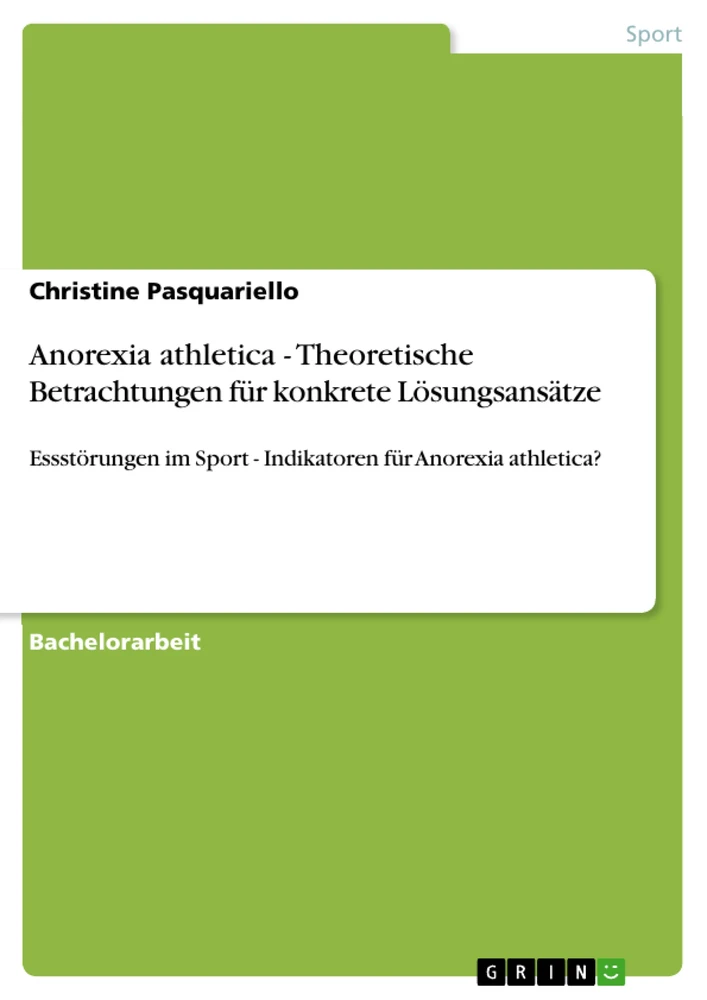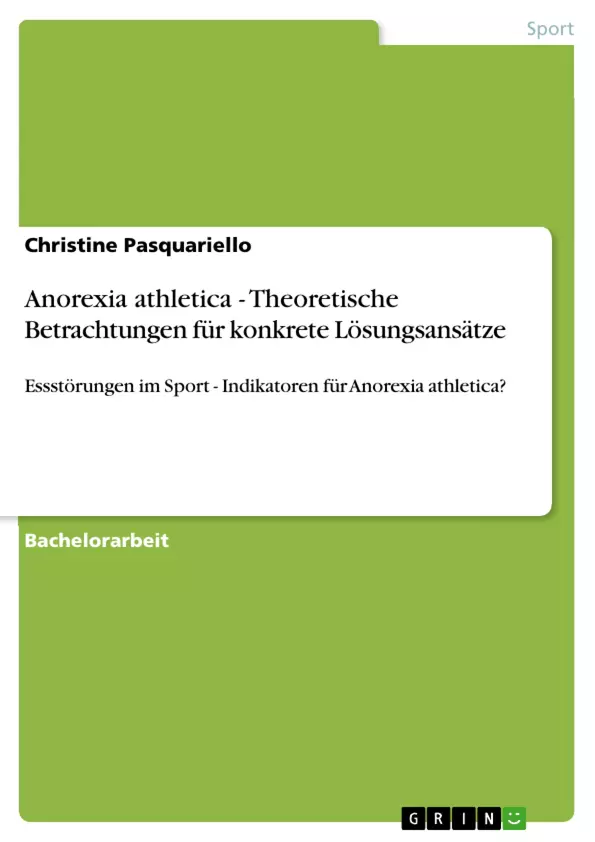Das Thema dieser Arbeit ist „Anorexia athletica: Theoretische Betrachtungen für konkrete Lösungsansätze“.Im Mittelpunkt steht die zentrale Forschungsfrage: Existiert eine Anorexia athletica unabhängig von anderen Essstörungen? Nach der Sichtung und Lektüre der zahlreichen Materialien war es möglich fünf Modelle zur Verbindung von Anorexia athletica und Anorexia nervosa zu erstellen:
Im ersten werden beide als sehr ähnliche Phänomene dargestellt. Im zweiten Modell überlappen sich die Anorexia athletica und die Anorexia nervosa. Das dritte Modell stellt beide als eigenständige Krankheiten dar, die von einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur
abhängig sind. Im vierten Modell sind sie ineinander verflochten und beeinflussen sich gegenseitig. Im letzten Modell wird gezeigt, dass aus einer Anorexia athletica eine Anorexia nervosa werden kann.
Auch wenn das medizinische und psychologische Forschungsfeld für Essstörungen noch Jahre des Studiums für eine endgültige Klassifizierung benötigen wird, ist es angebracht im Moment die Anorexia athletica als separate Kategorie zu betrachten. Das ist wichtig für die Ausbildung von Trainern/innen und Betreuern/innen.
In der Arbeit werden einige Programme und Schwerpunkte zur primären und sekundären Prävention diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Allgemeine Essstörungen und ihre Parallelen im Sport.
- 1.1. Klinische Definition und grundlegende Fragestellungen.
- 1.2. Einteilung von Essstörungen........
- 1.3. Epidemiologie
- 2. Anorexia nervosa
- 2.1. Ätiologie und Verlauf der Anorexia nervosa
- 2.1.1. Beschreibung.
- 2.1.2. Psychologische, soziologische und biologische Faktoren ..
- 2.1.3. Der Krankheitsprozess
- 3. Symptome der Anorexia athletica......
- 3.1. Medizinisch psychologische Kriterien zur Erkennung der Anorexia athletica .....
- 3.2. Woran können Außenstehende eine Essstörung erkennen?.
- 4. Ursachen und Auslöser der Anorexia athletica.
- 4.1. Gesellschaftliche Hintergründe .....
- 4.2. Die Rolle von Eltern, Trainern/innen, Mitbewerbern/innen und Kampfrichtern/innen
- 4.3. Weitere mögliche Auslöser
- 4.4. Besondere Essstörungen: Anorexia nervosa und Anorexia athletica:..\n ein Vergleich........
- 5. Auswirkungen auf den Körper
- 5.1. Female Triad...
- 5.2. Osteoporose
- 5.3. Amenorrhoe..\li>
- 5.4. Mangelerscheinungen .......
- 6. Fünf Modelle die den Unterschied zwischen der Anorexia athletica und der Anorexia\n nervosa aufzeigen .………………………….
- 7. Konkrete Lösungsansätze für die Anorexia athletica
- 7.1. Körperparameter für Trainer/innen und Betreuer/innen..\li>
- 7.1.1. Körpergewicht
- 7.1.2. Body Mass Index.
- 7.1.3. Körperfett..........\li>
- 7.2. Behandlung..\li>
- 7.2.1. Erziehungs- und Informationsprogramme..\li>
- 7.2.2. Prävention der Anorexia athletica und die Rolle der beteiligten Spezialisten/innen
- 7.2.3. Interventionen bei dem/der essgestörten Athleten/in.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Anorexia athletica: Theoretische Betrachtungen für konkrete Lösungsansätze“. Im Fokus steht die Frage, ob Anorexia athletica unabhängig von anderen Essstörungen existiert. Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle zur Verbindung von Anorexia athletica und Anorexia nervosa und diskutiert die Bedeutung einer separaten Betrachtung von Anorexia athletica.
- Klinische Definition und Abgrenzung von Anorexia athletica
- Ätiologie und Verlauf von Anorexia nervosa und Anorexia athletica
- Symptome und Risikofaktoren von Anorexia athletica
- Auswirkungen von Anorexia athletica auf den Körper
- Präventions- und Behandlungsansätze für Anorexia athletica
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Anorexia athletica“ ein und stellt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit vor.
- 1. Allgemeine Essstörungen und ihre Parallelen im Sport: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über allgemeine Essstörungen und ihre Erscheinungsformen im Sport. Es werden Definitionen, Einteilungen und epidemiologische Daten vorgestellt.
- 2. Anorexia nervosa: Dieses Kapitel befasst sich mit der Anorexia nervosa und ihren verschiedenen Facetten. Die Ätiologie, der Verlauf und die unterschiedlichen Faktoren, die zur Entstehung der Erkrankung beitragen, werden näher beleuchtet.
- 3. Symptome der Anorexia athletica: Dieses Kapitel präsentiert die Symptome der Anorexia athletica und beschreibt, wie diese von Außenstehenden erkannt werden können.
- 4. Ursachen und Auslöser der Anorexia athletica: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen und Auslöser von Anorexia athletica. Es werden sowohl gesellschaftliche Hintergründe als auch die Rolle von Eltern, Trainern/innen und Mitbewerbern/innen beleuchtet.
- 5. Auswirkungen auf den Körper: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Anorexia athletica auf den Körper. Es werden verschiedene gesundheitliche Folgen wie die Female Triad, Osteoporose, Amenorrhoe und Mangelerscheinungen beschrieben.
- 6. Fünf Modelle die den Unterschied zwischen der Anorexia athletica und der Anorexia nervosa aufzeigen: In diesem Kapitel werden fünf Modelle vorgestellt, die die Beziehung zwischen Anorexia athletica und Anorexia nervosa aufzeigen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten beleuchten.
- 7. Konkrete Lösungsansätze für die Anorexia athletica: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Lösungsansätze für Anorexia athletica. Es werden Körperparameter für Trainer/innen und Betreuer/innen sowie Präventions- und Behandlungsprogramme diskutiert.
Schlüsselwörter
Anorexia athletica, Anorexia nervosa, Essstörungen im Sport, Prävention, Behandlung, Körperparameter, Trainer/innen, Betreuer/innen, Female Triad, Osteoporose, Amenorrhoe, Mangelerscheinungen, Sportpsychologie, Ernährung, Leistungssport.
Häufig gestellte Fragen zu Anorexia athletica
Was ist Anorexia athletica?
Anorexia athletica ist eine Essstörung, die speziell im Sportumfeld auftritt, wobei das Streben nach Gewichtsreduktion primär der Leistungssteigerung dient.
Wie unterscheidet sie sich von Anorexia nervosa?
Während Anorexia nervosa oft tieferliegende psychische Ursachen hat, ist Anorexia athletica häufig an die sportliche Karriere gebunden und kann nach deren Ende wieder verschwinden, kann aber auch in eine nervöse Anorexie übergehen.
Was versteht man unter der "Female Triad"?
Die Female Triad ist ein Syndrom bei Sportlerinnen, das aus drei Komponenten besteht: Essstörung, Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhoe) und Knochenschwund (Osteoporose).
Welche Rolle spielen Trainer bei dieser Essstörung?
Trainer haben eine Schlüsselrolle; sie können durch Leistungsdruck Auslöser sein, sind aber auch wichtige Personen für die Früherkennung und Prävention.
Woran können Außenstehende eine Anorexia athletica erkennen?
Anzeichen sind extremes Training trotz Verletzungen, zwanghafte Beschäftigung mit Kalorien, deutlicher Gewichtsverlust und soziale Isolierung im Team.
- Quote paper
- Christine Pasquariello (Author), 2010, Anorexia athletica - Theoretische Betrachtungen für konkrete Lösungsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182459