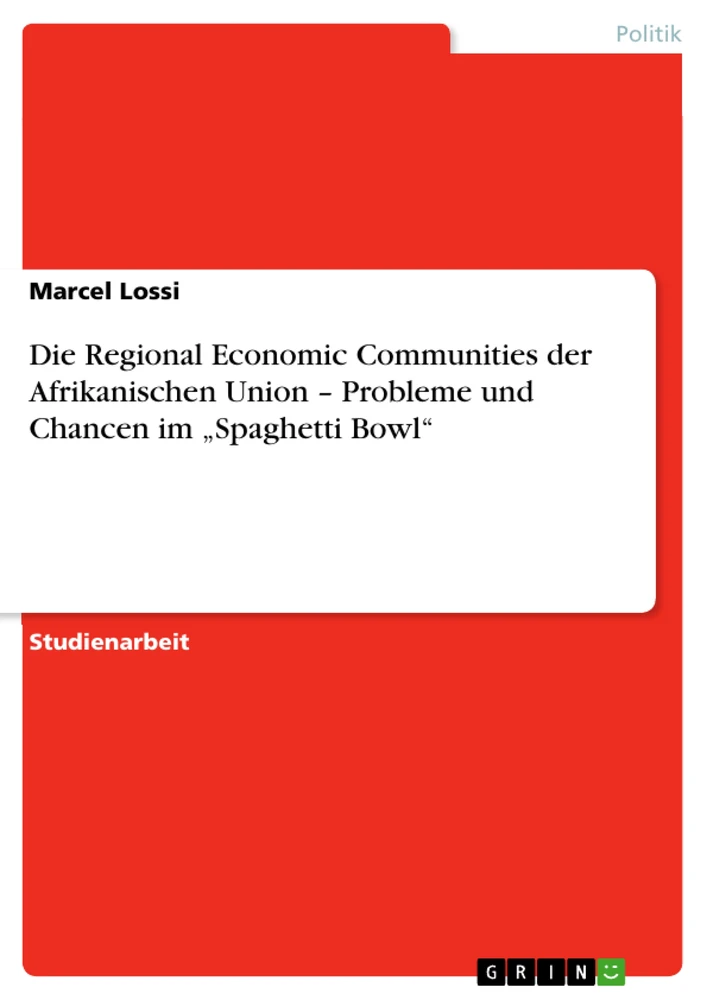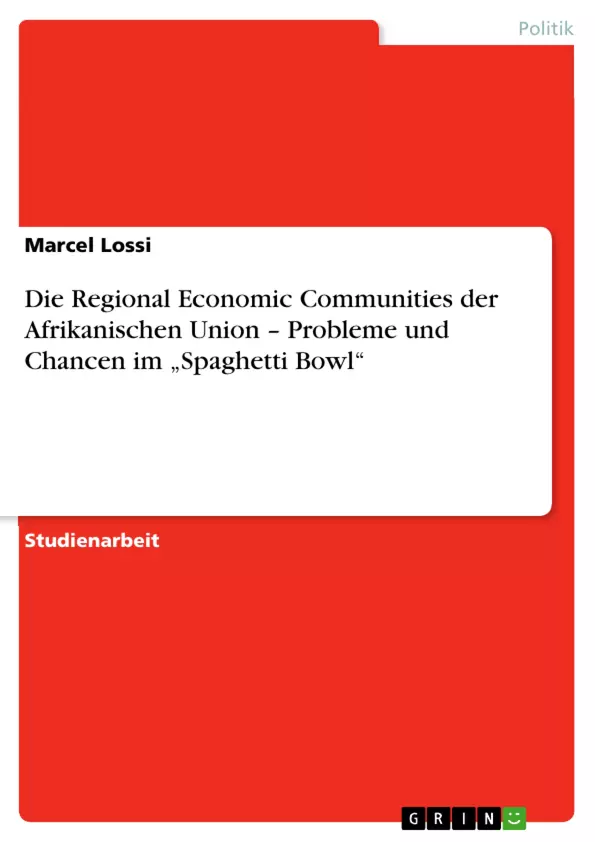1.Einleitung
Das Netzwerk der zwischenstaatlichen und überregionalen Beziehungen und Verträgen innerhalb von Afrika ist von kaum zu überschauender Vielfalt und Komplexität geprägt, was diesem System auch den Titel „Spaghetti Bowl“ eingebracht hat. Dieses komplexe Netzwerk, welches ja eigentlich Integration und Kooperation auf dem afrikanischen Kontinent steigern soll, wirkt aufgrund der mannigfaltigen Vertragsverpflichtungen, die teilweise auch widersprüchlich sind, aber letztlich integrationshemmend. Einen Ausweg aus diesem Dilemma soll eine Fixierung auf die von der AU anerkannten Regional Economic Communities (RECs) bieten, welche auch einen Kern der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur bilden. Diese anerkannten RECs sind: die Arab Maghreb Union (UMA), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD), East African Community (EAC), Economic Community of Central African States (ECCAS), Economic Community of West African States (ECOWAS), Intergovernmental Authority on Development (IGAD) sowie die Southern African Development Community (SADC). Einige dieser RECs, wie z.B. COMESA, sind aufgrund ihrer schieren regionsüberschreitenden Größe nicht geeignet, eine hohe integrative Kraft zu entfalten. Diese Arbeit wird sich daher exemplarisch auf die drei am Besten bekannten und regional beschränkten RECs SADC, ECOWAS und IGAD beschränken. Ich werde diese drei Organisationen kurz in Geschichte und Struktur vorstellen und dann als jeweiligen Schwerpunkt auf die Herausforderungen, Probleme und Chancen dieser Organisationen eingehen. Am Ende werde ich mit einem vergleichenden Fazit schließen und bewerten, welche REC die besten Zukunftsperspektiven besitzt. Aus theoretischer Sicht bietet es sich an, diese Organisationen mit Hilfe der Regional Security Complex Theory der Kopenhagener Schule zu betrachten, da es sich bei diesen RECs im Prinzip um institutionalisierte RSCs handelt. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit ist mir eine explizite Einbindung der Theorie nicht möglich, ich werde allerdings auf Aspekte der Kopenhagener Schule bei meiner Bewertung zurückgreifen. Hierbei werde ich mich insbesondere der Agenda und Stabilität der jeweiligen Ankerstaaten
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die SADC
- Entscheidende Probleme und Chancen
- Die IGAD
- Entscheidende Probleme und Chancen
- Die ECOWAS
- Entscheidende Probleme und Chancen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht exemplarisch drei Regional Economic Communities (RECs) der Afrikanischen Union – SADC, ECOWAS und IGAD – um deren Geschichte, Struktur und vor allem die Herausforderungen, Probleme und Chancen zu beleuchten. Ziel ist es, die jeweiligen Zukunftsperspektiven dieser Organisationen vergleichend zu bewerten und Aspekte der Kopenhagener Schule (Regional Security Complex Theory) einzubeziehen, insbesondere die Rolle der Ankerstaaten.
- Analyse der Geschichte und Struktur der SADC, ECOWAS und IGAD
- Identifizierung entscheidender Probleme und Chancen der jeweiligen RECs
- Bewertung der Zukunftsperspektiven der drei Organisationen
- Einbeziehung der Regional Security Complex Theory
- Analyse der Rolle der Ankerstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das komplexe Netzwerk zwischenstaatlicher Beziehungen in Afrika, den „Spaghetti Bowl“, und die Notwendigkeit, sich auf die von der AU anerkannten RECs zu konzentrieren. Die Arbeit fokussiert sich exemplarisch auf SADC, ECOWAS und IGAD, um deren Geschichte, Struktur, Herausforderungen und Chancen zu analysieren und die Zukunftsperspektiven zu bewerten. Die Regional Security Complex Theory der Kopenhagener Schule dient als theoretischer Hintergrund, wobei der Fokus auf der Agenda und Stabilität der Ankerstaaten liegt.
Die SADC: Die SADC-Region wird als klassischer, unipolares RSC mit Südafrika als dominierendem Akteur beschrieben. Die südafrikanische Dominanz resultiert aus der früheren Unabhängigkeit und dem Aufbau wirtschaftlicher und militärischer Stärke. Die SADCC (Southern African Development Conference), gegründet als Gegengewicht zu Südafrika, entwickelte sich nach dem Ende der Apartheid zur SADC. Die Arbeit beschreibt die Organisationsstruktur der SADC (Summit, Council of Ministers, Sekretariat, OPDS, SADC-Tribunal) und hebt die Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung hervor. Die anfänglichen Tendenzen zur Entwicklung einer Security Community wurden durch die Innenwendung Südafrikas unter Mbeki gebremst.
Schlüsselwörter
Afrikanische Union, Regional Economic Communities (RECs), SADC, ECOWAS, IGAD, „Spaghetti Bowl“, Integration, Kooperation, Ankerstaaten, Regional Security Complex Theory, Sicherheitspolitik, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Afrika: Regional Economic Communities (RECs) im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht drei Regional Economic Communities (RECs) der Afrikanischen Union – SADC, ECOWAS und IGAD – vergleichend. Sie beleuchtet deren Geschichte, Struktur, Herausforderungen, Probleme und Chancen und bewertet deren Zukunftsperspektiven. Die Regional Security Complex Theory (Kopenhagener Schule) dient als theoretischer Rahmen, insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Ankerstaaten.
Welche RECs werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich exemplarisch auf die SADC (Southern African Development Community), die ECOWAS (Economic Community of West African States) und die IGAD (Intergovernmental Authority on Development).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte und Struktur der drei RECs, identifiziert entscheidende Probleme und Chancen, bewertet deren Zukunftsperspektiven und analysiert die Rolle der Ankerstaaten im Kontext der Regional Security Complex Theory. Der "Spaghetti Bowl" Effekt des komplexen Netzwerks zwischenstaatlicher Beziehungen in Afrika wird in der Einleitung ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt die Regional Security Complex Theory?
Die Regional Security Complex Theory der Kopenhagener Schule dient als theoretischer Rahmen für die Analyse. Der Fokus liegt dabei auf der Agenda und Stabilität der Ankerstaaten innerhalb der jeweiligen RECs.
Wie wird die SADC beschrieben?
Die SADC-Region wird als klassischer, unipolares RSC mit Südafrika als dominierendem Akteur beschrieben. Die südafrikanische Dominanz begründet sich in der früheren Unabhängigkeit und dem Aufbau wirtschaftlicher und militärischer Stärke. Die Entwicklung von der SADCC zur SADC nach dem Ende der Apartheid wird ebenfalls beleuchtet, sowie die Organisationsstruktur und Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Afrikanische Union, Regional Economic Communities (RECs), SADC, ECOWAS, IGAD, „Spaghetti Bowl“, Integration, Kooperation, Ankerstaaten, Regional Security Complex Theory, Sicherheitspolitik, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist ein vergleichender Bewertung der Zukunftsperspektiven der drei Organisationen unter Berücksichtigung der genannten Aspekte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu SADC, ECOWAS und IGAD (jeweils mit Fokus auf Probleme und Chancen), und ein Fazit.
- Arbeit zitieren
- Marcel Lossi (Autor:in), 2010, Die Regional Economic Communities der Afrikanischen Union – Probleme und Chancen im „Spaghetti Bowl“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182469