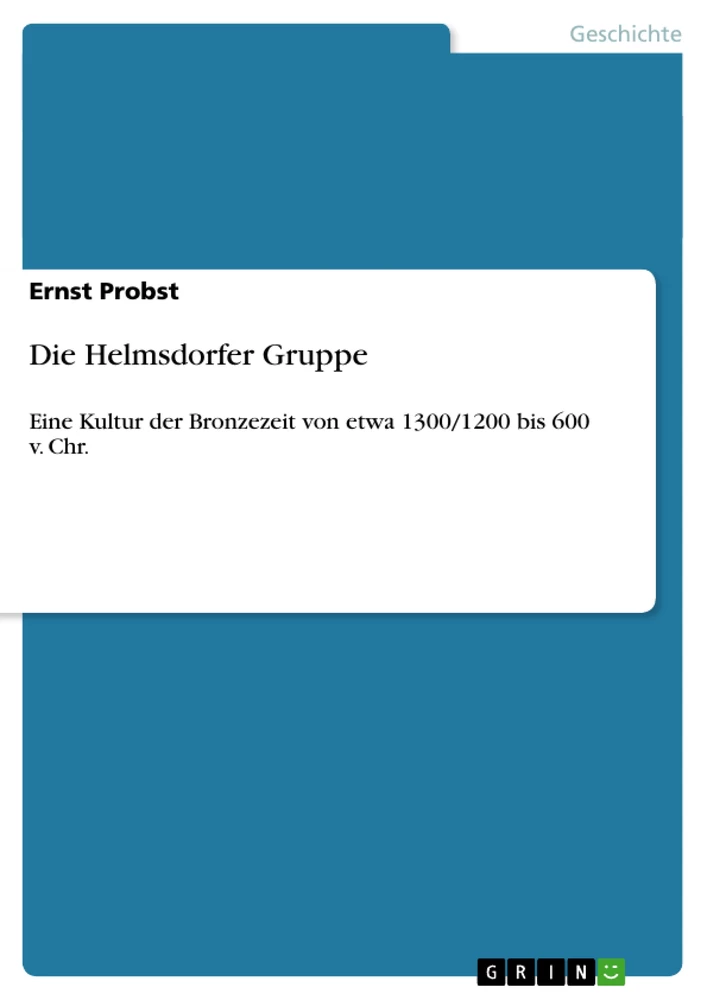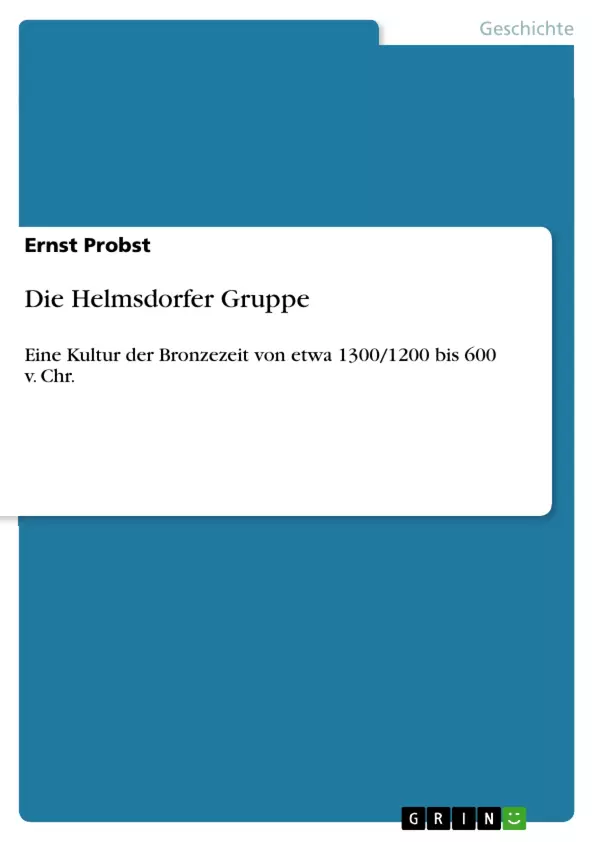Eine Kulturstufe, die in der Bronzezeit von etwa 1300/1200 bis 600 v. Chr. im östlichen und nördlichen Harzvorland von Sachsen-Anhalt existierte, steht im Mittelpunkt des Taschenbuches »Die Helmsdorfer Gruppe«. Geschildert werden die Siedlungen, Kleidung, der Schmuck, die Keramik, Werkzeuge, Waffen, Haustiere, Jagdtiere und die Religion der damaligen Ackerbauern, Viehzüchter und Bronzegießer. Verfasser dieses Taschenbuches ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst. Er hat sich vor allem durch seine Werke »Deutschland in der Urzeit« (1986), »Deutschland in der Steinzeit« (1991) und »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) einen Namen gemacht. Das Taschenbuch »Die Helmsdorfer Gruppe« ist Dr. Rolf Breddin, Professor Dr. Claus Dobiat, Professor Dr. Markus Egg, Professor Dr. Hans-Eckart Joachim, Professor Dr. Albrecht Jockenhövel, Professor Dr. Horst Keiling, Professor Dr. Rüdiger Krause, Dr. Friedrich Laux, Professor Dr. Berthold Schmidt, Dr. Klaus Simon und Dr. Otto Mathias Wilbertz gewidmet, die den Autor mit Rat und Tat bei den Recherchen über Kulturen der Spätbronzezeit für sein Buch »Deutschland in der Bronzezeit« unterstützt haben. Es enthält Lebensbilder der wissenschaftlichen Graphikerin Friederike Hilscher-Ehlert aus Königswinter.
Inhaltsverzeichnis
- Die Helmsdorfer Gruppe
- Eine Kultur der Bronzezeit
- von etwa 1300/1200 bis 600 v. Chr.
- Widmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Helmsdorfer Gruppe, einer Kultur der Bronzezeit, die von etwa 1300/1200 bis 600 v. Chr. in Deutschland existierte. Die Arbeit zielt darauf ab, die Kultur der Helmsdorfer Gruppe zu beschreiben und zu analysieren, indem sie archäologische Funde und wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenführt.
- Die Entstehung und Entwicklung der Helmsdorfer Gruppe
- Die materiellen Hinterlassenschaften der Helmsdorfer Gruppe
- Die Lebensweise und die sozialen Strukturen der Helmsdorfer Gruppe
- Die Beziehungen der Helmsdorfer Gruppe zu anderen Kulturen der Bronzezeit
- Die Bedeutung der Helmsdorfer Gruppe für die Geschichte Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einer Einleitung, die die Helmsdorfer Gruppe in den Kontext der Bronzezeit in Deutschland einordnet. Es werden die wichtigsten archäologischen Fundstellen und die wichtigsten Merkmale der Helmsdorfer Kultur vorgestellt. Anschließend werden die materiellen Hinterlassenschaften der Helmsdorfer Gruppe im Detail beschrieben, darunter Werkzeuge, Waffen, Schmuck und Keramik. Die Lebensweise und die sozialen Strukturen der Helmsdorfer Gruppe werden anhand von archäologischen Befunden und vergleichenden Studien rekonstruiert. Das Buch beleuchtet auch die Beziehungen der Helmsdorfer Gruppe zu anderen Kulturen der Bronzezeit, insbesondere zu den Kulturen der Nordsee und des Mittelmeers. Abschließend wird die Bedeutung der Helmsdorfer Gruppe für die Geschichte Deutschlands diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Helmsdorfer Gruppe, die Bronzezeit, die Archäologie, die Kulturgeschichte, die materiellen Hinterlassenschaften, die Lebensweise, die sozialen Strukturen, die Beziehungen zu anderen Kulturen und die Bedeutung für die Geschichte Deutschlands.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2011, Die Helmsdorfer Gruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182515