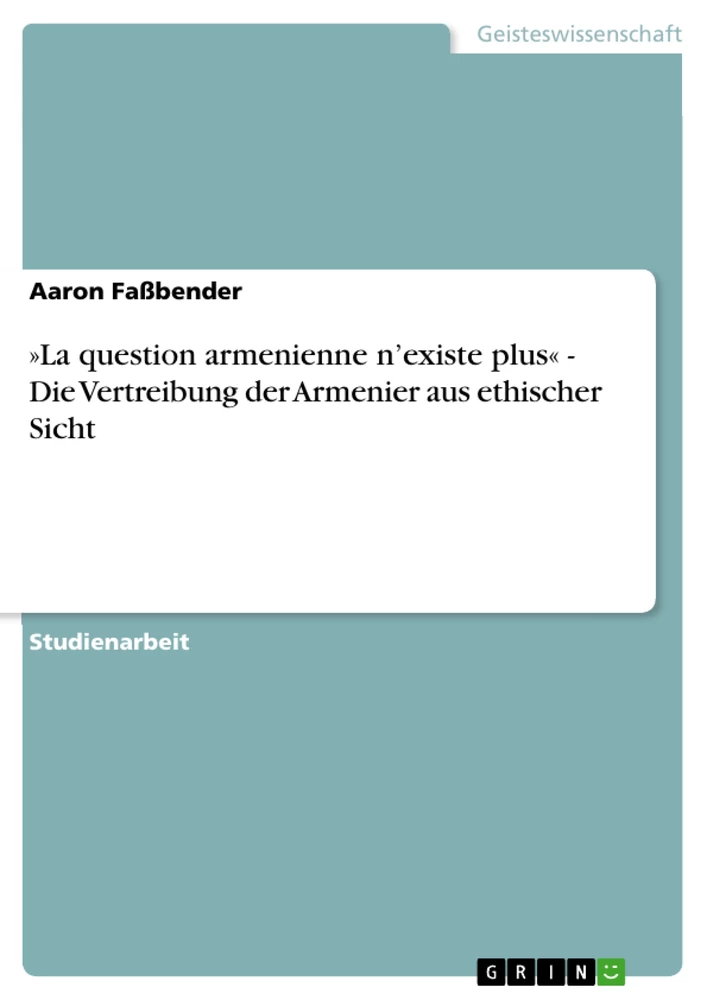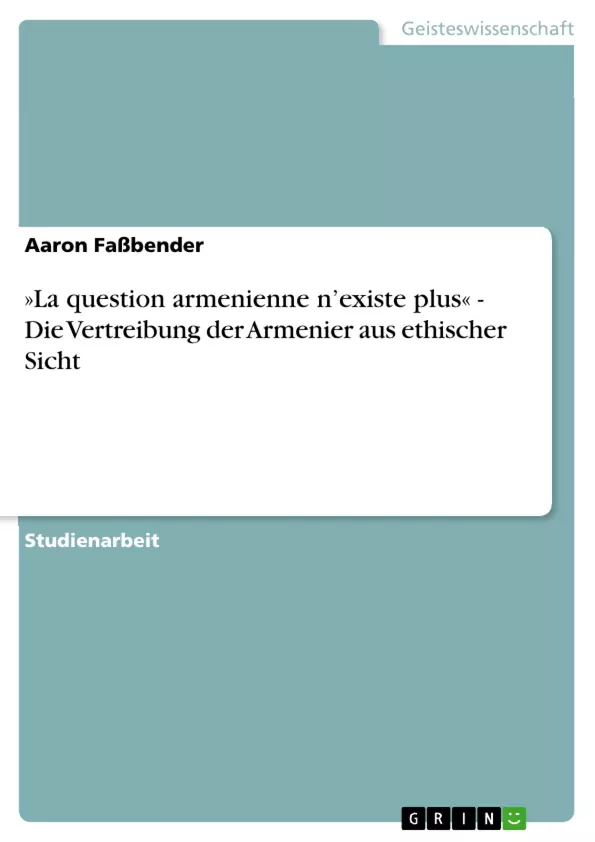Neunzig Jahre sind seit der gewaltsamen Vertreibung der Armenier aus dem Osmanischen Reich vergangen, doch nach wie vor bleiben wesentliche Fragen unbeantwortet. Dabei mangelt es nicht am öffentlichen Interesse, wie durch zahlreiche Zeitungsberichte und Veröffentlichungen zu belegen wäre. Die Aufarbeitung der Geschehnisse gestaltet sich nicht zuletzt deswegen problematisch, weil die Positionen unterschiedlicher kaum sein könnten: Während die Vertreibung im kollektiven Gedächtnis der Armenier als sayfo (das Jahr des Schwertes, 1915) oder mets jerern (der große Frevel/das große Verbrechen) einzog, wird in der Türkei von offizieller Seite nach wie vor jede Verantwortung für die Vertreibungen und den damit einhergehenden Massakern abgestritten. Außerhalb Kleinasiens hat sich weitestgehend die armenische Lesart durchsetzen können, wenngleich die historische Erschließung nach wie vor lückenhaft ist.
Bedauerlicherweise sind die Motive für eine Auseinandersetzung mit den Vertreibungen häufig nicht im Interesse der Aufklärung der historischen Ereignisse oder dem Gedenken an die Opfer begründet. So werden die armenischen Opfer instrumentalisiert, um einen befürchteten EU-Beitritt der Türkei zu verhindern, oder zumindest zu verzögern.
Die unterschiedliche Umgangsweise mit den Vertreibungen soll nun im Verlauf der vorliegenden Arbeit thematisiert werden. Dabei wird zunächst die Aufarbeitung in den betroffenen Nationen, der Türkei und Armenien, betrachtet und schließlich mit der vermeintlich objektiveren Sichtweise des westlichen Auslandes verglichen werden. Hierzu bietet sich ein Blick nach Deutschland besonders an, da dem Deutschen Reich, durch sein Bündnis mit dem Osmanischen Reich, eine Mitwisserschaft wenn nicht gar eine Mittäterschaft unterstellt werden kann. Die Betrachtungen zur öffentlichen und wissenschaftlichen Erinnerung sollen ferner zur Erörterung der Frage herangezogen werden, wie in der Gegenwart mit den Opfern und Tätern jener Zeit umgegangen wird.
(Anm.: Die hier abgebildete Einleitung enthält keine Fußnoten)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsstand und verwendete Literatur
- 2. Die Vertreibung der Armenier aus historischer Sicht
- 2.1 Die gesetzliche Gleichstellung und das Ende der Toleranz
- 2.2 Der Artikel 61 und das hamidische System
- 2.3 Die Pogrome von 1895 am Vorabend der Vertreibung
- 2.4 „La question armenienne n'existe plus“
- 2.5 Die Rekonstruktion des Genozids
- 3. Die Vertreibung der Armenier aus der Täterperspektive
- 3.1 Die Verdrängung des Genozids
- 4. Die Vergangenheitsbewältigung der Opfer
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vertreibung der Armenier aus dem Osmanischen Reich aus ethischer Perspektive. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Ereignisse, insbesondere den Gegensatz zwischen der armenischen Sichtweise und der offiziellen türkischen Position. Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten der historischen Aufarbeitung und den Einfluss politischer und ideologischer Faktoren auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Vertreibung der Armenier (armenisch, türkisch, westlich).
- Die Rolle der historischen Forschung und die Schwierigkeiten der Objektivität.
- Die Vergangenheitsbewältigung in der Türkei und Armenien.
- Der Einfluss politischer Interessen auf die Interpretation der Ereignisse.
- Ethische Bewertung der Vertreibung im Kontext des Völkermords.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Problematik der Aufarbeitung der Vertreibung der Armenier, 90 Jahre nach dem Ereignis. Sie betont die gegensätzlichen Positionen: die armenische Sichtweise, die von einem Genozid spricht, und die türkische, die jegliche Verantwortung bestreitet. Die Einleitung kündigt an, die unterschiedlichen Perspektiven und die Schwierigkeiten einer objektiven Betrachtungsweise zu analysieren. Sie weist auf die Instrumentalisierung der Opfer hin, beispielsweise im Kontext der Diskussion um einen EU-Beitritt der Türkei. Schließlich wird der Fokus auf Deutschland gelegt, angesichts des Bündnisses des Deutschen Reichs mit dem Osmanischen Reich.
2. Die Vertreibung der Armenier aus historischer Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Hintergründe der Vertreibung. Es untersucht die zunehmende Diskriminierung der armenischen Bevölkerung, die gesetzliche Ungleichstellung und das Ende der Toleranz, den Einfluss des Artikels 61 und des hamidischen Systems. Das Kapitel beschreibt die Pogrome von 1895 und den propagandistischen Slogan "La question armenienne n'existe plus", der die systematische Vertreibung und Vernichtung rechtfertigen sollte. Abschließend wird der Versuch einer Rekonstruktion des Genozids angesprochen. Die Kapitelteile beleuchten schrittweise den Weg von rechtlicher Benachteiligung über systematische Gewalt bis hin zur vollständigen Deportation. Der Fokus liegt auf dem Kontextualisieren der Ereignisse und dem Herausarbeiten von Ursachen und Zusammenhängen.
3. Die Vertreibung der Armenier aus der Täterperspektive: Dieses Kapitel analysiert die Sichtweise der Täter und deren Strategien der Vergangenheitsbewältigung. Ein zentraler Punkt ist die Verdrängung des Genozids in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion. Es wird auf die selektive und unsystematische Verwendung von Quellen hingewiesen und die Rolle der politischen und ideologischen Voreingenommenheit bei der Interpretation der Ereignisse kritisiert. Das Kapitel untersucht, wie die türkische Seite die Ereignisse darstellt und versucht, die eigenen Handlungen zu rechtfertigen oder zu relativieren.
4. Die Vergangenheitsbewältigung der Opfer: Dieses Kapitel befasst sich mit der Auseinandersetzung der Opfer mit ihrer Vergangenheit. Es untersucht die unterschiedlichen Strategien des Gedenkens und der Aufarbeitung in Armenien und der Diaspora. Der Fokus liegt darauf wie die Nachfahren der Opfer die Vertreibung und den Völkermord verarbeiten und wie diese Erfahrung ihr Leben prägt. Es wird auf die Herausforderungen der Traumabewältigung und der Suche nach Gerechtigkeit eingegangen.
Schlüsselwörter
Armenische Vertreibung, Genozid, Osmanisches Reich, Türkei, Armenien, historische Aufarbeitung, Vergangenheitsbewältigung, Täterperspektive, Opferperspektive, politische Instrumentalisierung, wissenschaftliche Objektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Vertreibung der Armenier
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vertreibung der Armenier aus dem Osmanischen Reich aus ethischer Perspektive. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Ereignisse, insbesondere den Gegensatz zwischen der armenischen Sichtweise und der offiziellen türkischen Position. Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten der historischen Aufarbeitung und den Einfluss politischer und ideologischer Faktoren auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die armenische, die türkische und die westliche Perspektive auf die Vertreibung der Armenier. Sie analysiert die unterschiedlichen Interpretationen und die Schwierigkeiten, eine objektive Sichtweise zu erreichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die unterschiedlichen Perspektiven auf die Vertreibung, die Rolle der historischen Forschung und die Schwierigkeiten der Objektivität, die Vergangenheitsbewältigung in der Türkei und Armenien, den Einfluss politischer Interessen auf die Interpretation der Ereignisse und eine ethische Bewertung der Vertreibung im Kontext des Völkermords.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, die Vertreibung der Armenier aus historischer Sicht, die Vertreibung aus der Täterperspektive, die Vergangenheitsbewältigung der Opfer und Schluss. Die Einleitung skizziert die Problematik und die gegensätzlichen Positionen. Kapitel 2 beleuchtet die historischen Hintergründe, Kapitel 3 die Sichtweise der Täter, Kapitel 4 die der Opfer. Die Arbeit enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel über die historische Sicht der Vertreibung behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die zunehmende Diskriminierung der armenischen Bevölkerung, die gesetzliche Ungleichstellung, den Artikel 61 und das hamidische System, die Pogrome von 1895, den Slogan "La question armenienne n'existe plus" und den Versuch einer Rekonstruktion des Genozids. Es beleuchtet den Weg von rechtlicher Benachteiligung über systematische Gewalt bis hin zur vollständigen Deportation.
Wie wird die Täterperspektive behandelt?
Das Kapitel über die Täterperspektive analysiert die Sichtweise der Täter und deren Strategien der Vergangenheitsbewältigung, insbesondere die Verdrängung des Genozids in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion. Es kritisiert die selektive Verwendung von Quellen und den Einfluss politischer und ideologischer Voreingenommenheit.
Wie wird die Vergangenheitsbewältigung der Opfer dargestellt?
Das Kapitel über die Opferperspektive befasst sich mit der Auseinandersetzung der Opfer mit ihrer Vergangenheit, den Strategien des Gedenkens und der Aufarbeitung in Armenien und der Diaspora, der Traumabewältigung und der Suche nach Gerechtigkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Armenische Vertreibung, Genozid, Osmanisches Reich, Türkei, Armenien, historische Aufarbeitung, Vergangenheitsbewältigung, Täterperspektive, Opferperspektive, politische Instrumentalisierung, wissenschaftliche Objektivität.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit der armenischen Vertreibung auf strukturierte und professionelle Weise.
- Quote paper
- M. A. Aaron Faßbender (Author), 2005, »La question armenienne n’existe plus« - Die Vertreibung der Armenier aus ethischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182518