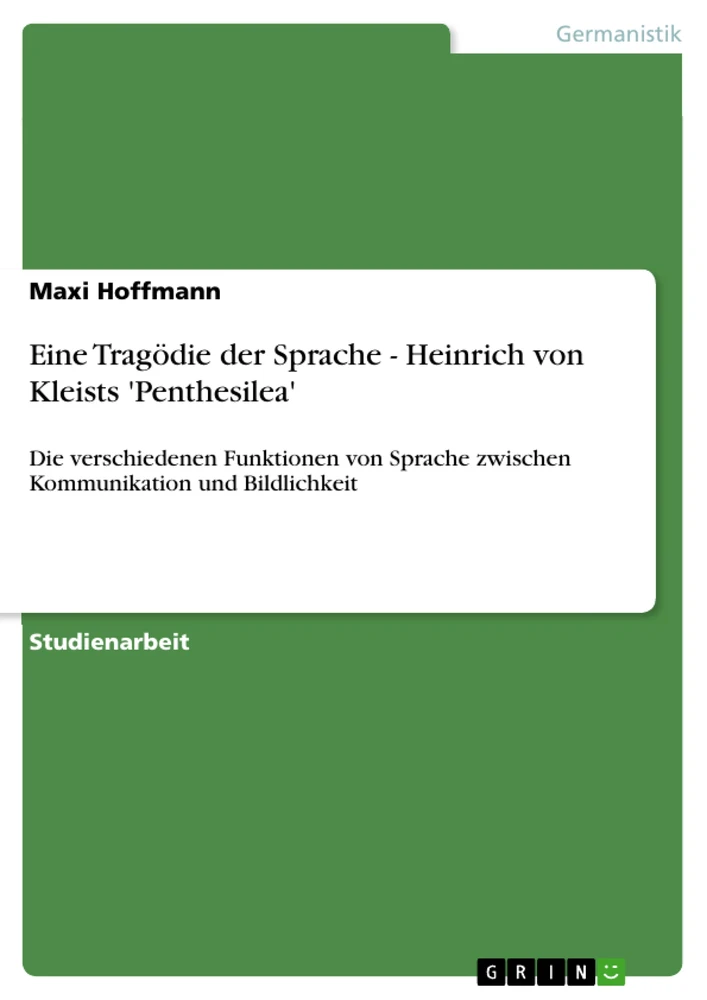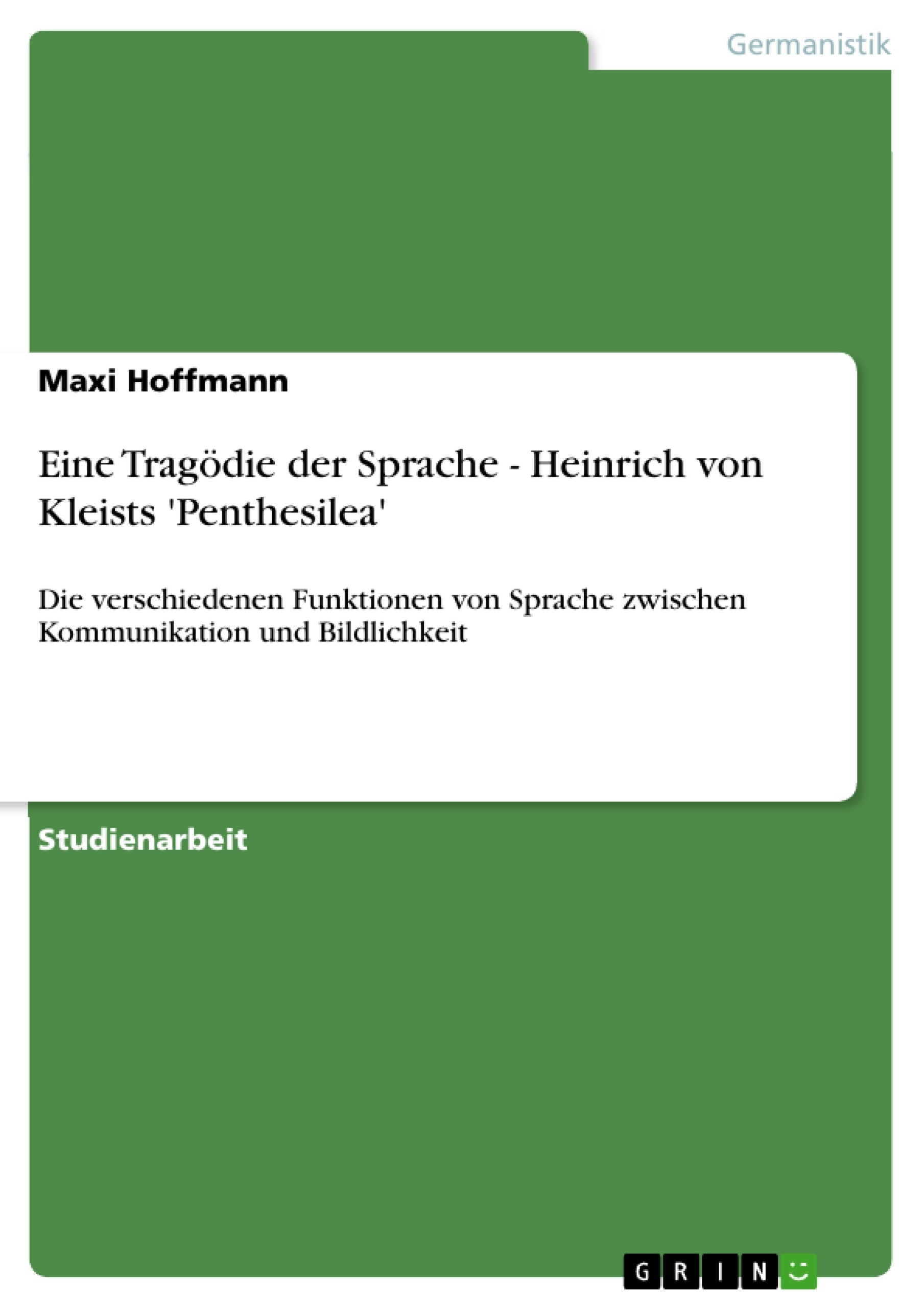Über das 1808 erschienene Trauerspiel Penthesilea von Heinrich von Kleist wurde häufig bezüglich seiner Bühnentauglichkeit diskutiert. Die Häufung von narrativen Elementen wie Botenbericht und Teichoskopie ist ungewöhnlich für ein Drama und führt nicht nur auf der Bühne zu einer anderen Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Daher scheint es unerlässlich, sich auch darüber hinaus näher mit der Sprache des Stückes zu beschäftigen. Ziel dieser Hausarbeit soll es daher sein, die verschiedenen Funktionen und Wirkungsweisen von Sprache in Kleists Penthesilea zu untersuchen und vor allem die Frage zu klären, inwieweit die Sprache Einfluss auf den Handlungsverlauf nimmt und man tatsächlich von einer „Tragödie der Sprache“ sprechen kann.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Sprache als Kommunikationsmittel. Der zweite Teil geht auf die Sprachlosigkeit im Stück und die narrative Informationsvermittlung ein. Der dritte Teil beleuchtet schließlich die metaphorische Kraft der Sprache in Penthesileas Selbstmord.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung der Sprache in Heinrich von Kleists Penthesilea
- Die Sprache als Kommunikationsmittel
- Sprachlosigkeit und Narrative Elemente im Trauerspiel
- Penthesileas Selbstmord als Beispiel für die Kraft der Sprache
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die verschiedenen Funktionen und Wirkungsweisen der Sprache in Kleists Penthesilea. Sie untersucht, wie Sprache den Handlungsverlauf beeinflusst und inwieweit man von einer „Tragödie der Sprache“ sprechen kann.
- Die Rolle der Sprache als Kommunikationsmittel im Stück
- Die Sprachlosigkeit in Penthesilea und die narrative Informationsvermittlung
- Die metaphorische Kraft der Sprache in Penthesileas Selbstmord
- Die Bedeutung der Sprachbarrieren zwischen Penthesilea und Achill
- Die Auswirkungen von Missverständnissen und Mehrdeutigkeiten in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Sprache als Kommunikationsmittel in Penthesilea. Hier wird untersucht, wie die verschiedenen Figuren im Stück Sprache verwenden, um miteinander zu kommunizieren, und welche Herausforderungen und Missverständnisse dabei auftreten.
Das zweite Kapitel analysiert die Sprachlosigkeit im Stück und die narrative Informationsvermittlung. Es befasst sich mit den verschiedenen narrativen Elementen, die Kleist einsetzt, um Informationen zu vermitteln, und wie diese die Handlung beeinflussen.
Das dritte Kapitel analysiert die metaphorische Kraft der Sprache in Penthesileas Selbstmord. Es wird untersucht, wie Penthesilea die Sprache in ihrer Selbsttötung verwendet und welche Bedeutung dies für die Interpretation des Stückes hat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen: Sprache, Kommunikation, Sprachlosigkeit, Narrativität, Bildlichkeit, Metapher, Tragödie, Penthesilea, Heinrich von Kleist, Achill, Penthesilea, Amazonen, Griechen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Kleists „Penthesilea“ als „Tragödie der Sprache“ bezeichnet?
Weil die Sprache im Stück nicht nur der Kommunikation dient, sondern durch Missverständnisse, Mehrdeutigkeiten und Sprachbarrieren maßgeblich zum tragischen Scheitern der Helden beiträgt.
Welche Rolle spielen Botenberichte und Teichoskopie?
Diese narrativen Elemente vermitteln Informationen über Handlungen, die nicht direkt auf der Bühne stattfinden, und verstärken die Distanz zwischen Geschehen und Sprache.
Wie beeinflusst die Sprache Penthesileas Selbstmord?
Penthesilea nutzt die metaphorische Kraft der Sprache, um sich selbst zu töten, indem sie den Dolch durch Worte ersetzt – ein Extrembeispiel für die Macht der Sprache über die Realität.
Welche Kommunikationsprobleme bestehen zwischen Penthesilea und Achill?
Ihre Kommunikation ist durch kulturelle Unterschiede zwischen Amazonen und Griechen sowie durch individuelle Fehlinterpretationen der Absichten des anderen geprägt.
Was wird im Hinblick auf die Bühnentauglichkeit diskutiert?
Kritiker bemängeln oft die Häufung narrativer Elemente, die für ein klassisches Drama ungewöhnlich sind und die direkte Aktion durch sprachliche Berichte ersetzen.
- Citation du texte
- Maxi Hoffmann (Auteur), 2009, Eine Tragödie der Sprache - Heinrich von Kleists 'Penthesilea', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182521