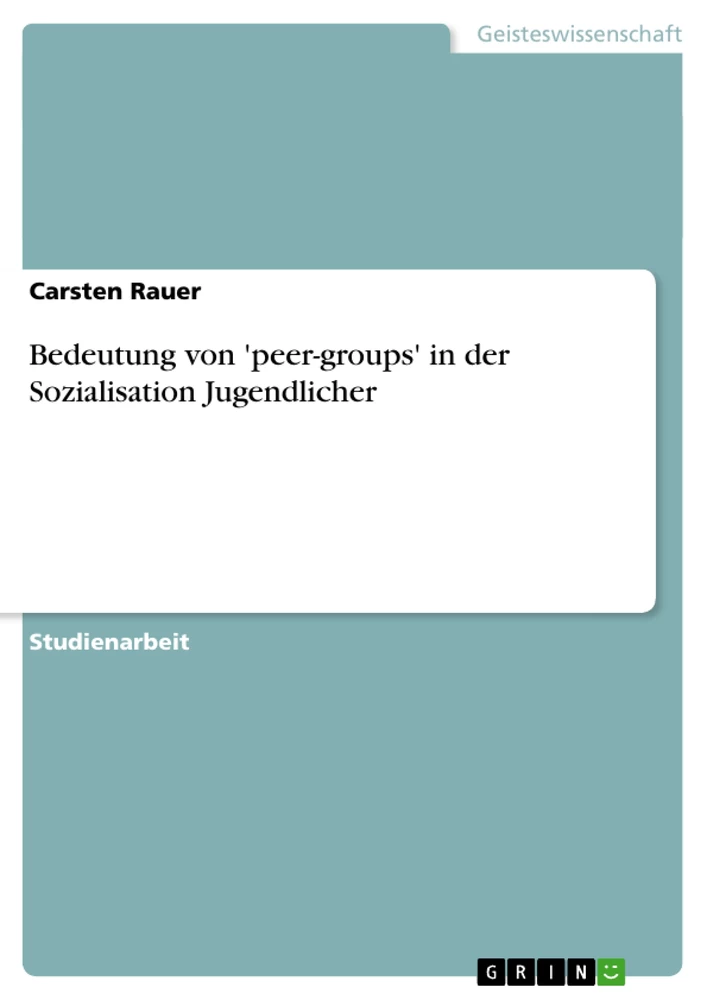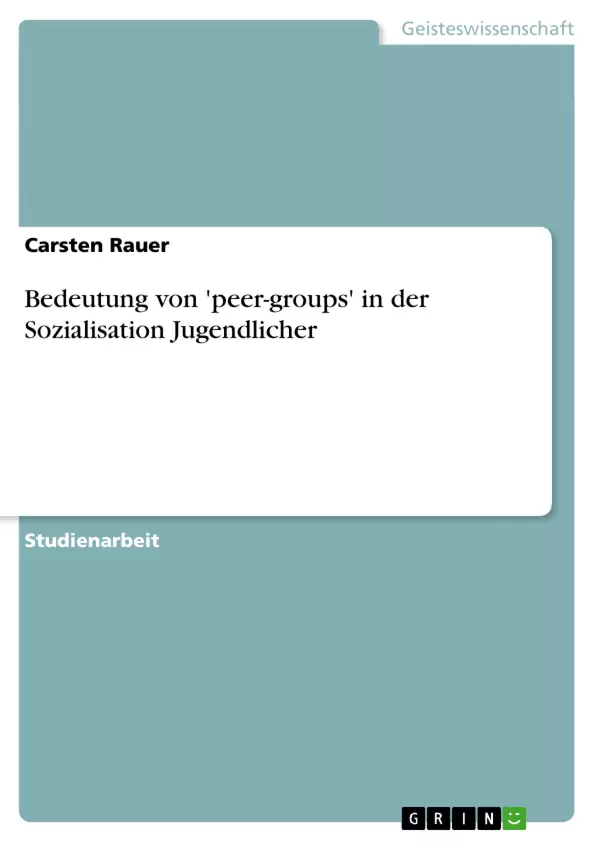Die Lebensphase der Jugend hält für den jungen Menschen einige Entwicklungsaufgaben bereit, die es zu bewältigen gilt. Da wäre zum Beispiel die Abnabelung vom Elternhaus, die Auseinandersetzung mit der Berufswahl und der darauf folgenden Ausbildung oder der erste intensivere Kontakt mit dem anderen Geschlecht, bzw. die sexuelle Orientierung. Am Ende einer solcher Kette von Konflikte soll dann die Ich - Identität herausgebildet sein. Bis es aber soweit kommt, muss ein Weg gefunden werden, diese Konflikte zu bewältigen. Zunächst bedeutet dieses für den Jugendlichen allerdings eine gewisse Desorientierung. Die peer - groups stellen einen entscheidenden Faktor dar, möglich Probleme aufzuarbeiten.
Wie entstehen nun solche peer-groups und wie stark nehmen sie tatsächlich Einfluss auf die Entwicklung und Identitätsfindung eines Jugendlichen?
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsangabe
- Einleitung
- Definition: „peer - groups“
- Entstehung und Struktur
- Jugendliche Subkulturen - abweichende Normen und Werte
- Funktion und Wirkung von peer-groups
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Peer-Groups in der Sozialisation Jugendlicher. Sie analysiert die Entstehung und Struktur von Peer-Groups, ihre Normen und Werte sowie ihre Auswirkungen auf die Entwicklung und Identitätsfindung von Jugendlichen.
- Definition und Bedeutung von Peer-Groups
- Entstehung und Struktur von Peer-Groups
- Einfluss von Peer-Groups auf Normen und Werte
- Funktion und Wirkung von Peer-Groups in der Sozialisation
- Bedeutung von Peer-Groups für die Identitätsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Peer-Groups in der Jugendphase heraus und gibt einen Überblick über die Themen, die in der Arbeit behandelt werden. Das dritte Kapitel liefert eine Definition des Begriffs „peer - groups“ und skizziert die sozialgeschichtliche Entwicklung von Gleichaltrigengruppen.
Das vierte Kapitel geht auf die Entstehung und Struktur von Peer-Groups ein. Es beleuchtet die Bedeutung von Subkulturen und deren abweichenden Normen und Werten.
Das fünfte Kapitel analysiert die Funktion und Wirkung von Peer-Groups auf die Sozialisation Jugendlicher. Hierbei werden die verschiedenen Möglichkeiten der Einflussnahme von Peer-Groups auf die Entwicklung und Identitätsfindung von Jugendlichen untersucht.
Schlüsselwörter
Peer-Groups, Sozialisation, Jugend, Identitätsfindung, Subkulturen, Normen, Werte, Einfluss, Funktion, Wirkung, Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Peer-Group?
Eine Peer-Group ist eine Gruppe von Gleichaltrigen, die für Jugendliche als wichtiges soziales Umfeld außerhalb der Familie dient.
Welche Funktion haben Peer-Groups in der Jugendphase?
Sie unterstützen die Abnabelung vom Elternhaus, bieten Orientierung bei der Identitätsfindung und helfen bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben.
Können Peer-Groups negative Einflüsse haben?
Ja, durch abweichende Normen und Werte in Subkulturen kann es zu Konformitätsdruck kommen, der riskantes Verhalten oder Desorientierung begünstigen kann.
Wie entstehen Peer-Groups?
Sie entstehen meist spontan durch gemeinsame Interessen, ähnliche Lebenslagen oder räumliche Nähe (Schule, Viertel) und weisen oft eine informelle Struktur auf.
Welchen Einfluss haben Peer-Groups auf die Ich-Identität?
In der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen testen Jugendliche verschiedene Rollen und Werte, was letztlich zur Herausbildung einer stabilen eigenen Identität beiträgt.
- Arbeit zitieren
- Carsten Rauer (Autor:in), 2001, Bedeutung von 'peer-groups' in der Sozialisation Jugendlicher, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18257